Handelsblatt | Oktober 2025
Eine unabhängige Kampagne von Contentway

Handelsblatt | Oktober 2025
Eine unabhängige Kampagne von Contentway




Partner Content | WTS
MIT KI IN DIE NÄCHSTE ÄRA DER STEUERBERATUNG
Im Interview erklärt Michel Braun, wie generative KI neue Möglichkeiten für Analyse, Automatisierung und Beratung im Steuerbereich eröffnet.
Großes Interview | Peter Sarlin
Europa hat zwar keine Big-Tech-Plattformen, aber sehr starke Industrien. Peter Sarlin, führender Experte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Co-Founder und CEO von AMD SILO AI, ist fest davon überzeugt, dass europäische Unternehmen führend im Bereich der KI werden können – wenn sie jetzt mutig investieren.
Partner Content | Jülich Supercomputing Centre (JSC)
Supercomputer sind keine Zukunftsvision, sondern längst Realität. Sie helfen beim Entschlüsseln des Klimas, beim Entwickeln neuer Medikamente – und treiben die Künstliche Intelligenz an. In Jülich ist mit „JUPITER“ Europas erster Exascale-Rechner in Betrieb. Prof. Lippert erklärt, was er leisten soll.
Interview | Prof. Dr. Ariel Dora Stern
KI-Expertin Prof. Dr. Ariel Dora Stern über die Notwendigkeit digitaler Weiterbildung, Klinik-Hürden und wie KI die Versorgung menschlicher macht.

AUSGABE #192
Key Account Manager:
Mira Khanna
Geschäftsführung:
Nicole Bitkin, Fredrik Thorsson
Head of Content & Media Production:
Aileen Reese
Redaktion und Grafik:
Aileen Reese, Nadine Wagner, Caroline Strauß, Negin Tayari
Text:
Katja Deutsch, Julia Butz, Thomas Soltau
Coverfoto:
Adobe Firefly, Presse/WTS, Presse, Forschungszentrum Jülich
Distribution & Druck:
Handelsblatt, Oktober 2025
Contentway
Wir erstellen Online- und Printkampagnen mit wertvollen und interessanten Inhalten, die an relevante Zielgruppen verteilt werden. Unser Partner Content und Native Advertising stellt Ihre Geschichte in den Vordergrund.
Die Inhalte des „Partner Content“ und „Hotspot Highlight“ in dieser Kampagne wurden in Zusammenarbeit mit unseren Kunden erstellt und sind Anzeigen.
Für die Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum. Die Formulierungen sprechen alle Geschlechter gleichberechtigt an. Contentway und Handelsblatt sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen.
Herausgegeben von:
Contentway GmbH
Neue Burg 1
DE-20457 Hamburg
Tel.: +49 40 85539750
E-Mail: info@contentway.de Web: www.contentway.de
Folge uns auf Social Media:
WEITERE INHALTE
04. Dr. Paulina Prantl, Fraunhofer IIS
14. Dr. Sylke Piéch, DFKI
16. Prof. Dr. Yasmin Weiß, TH Nürnberg
19. Geschichte der KI
20. Dr. Joachim Lentes, Fraunhofer IAO
CONTENTWAY.DE
Technik am Puls der Lieferkette Künstliche Intelligenz und Process Mining optimieren nicht nur Effizienz und Transparenz, sondern verknüpfen digitale Innovation direkt mit nachhaltigen Zielen.
EINLEITUNG
Wir stehen nicht am Bahnsteig, wir sind schon unterwegs. Unternehmen können KI bereits heute in Prozesse und Produkte integrieren. Wer wartet, verliert Wahlfreiheit und Tempo.
Foto: 2025 DFKI/Oliver Dietze
Es gibt zwei Wege in die Praxis: Abläufe verschlanken und Produkte veredeln. Letzteres ist für viele Unternehmen der Hebel für Zukunftsfähigkeit. Weltmarktführer können ihre Nischen nur halten, wenn sie ihre Produkte mit lernenden Funktionen ergänzen. Dafür braucht es keine „Wundermodelle“. Ärmel hochkrempeln, vorhandene Modelle, besonders kleinere Open-SourceModelle, die auch aus Europa kommen, z. B. Mistral, nutzen und ins Operative bringen: Das ist der klare Weg.
Dafür müssen Unternehmen eigene Strukturen schaffen. Viele Mittelständler bauen bereits kleine KI-Teams auf, denn die KI-Transformation lässt sich nicht einfach outsourcen. Partner helfen bei der Umsetzung aber die Expertise bleibt im Haus. Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) arbeiten wir in einem Public-PrivatePartnership-Modell: Der Großteil unse rer Projekte entsteht in Zusammenarbeit mit Industriepartnern. Das ist Absicht: Die Forschung soll andocken, nicht im Labor liegen bleiben. Die Wissenschaft
und die Wirtschaft müssen sich zusammentun, dadurch profitiert der Standort Deutschland. Digitale Souveränität bedeutet für mich Wahlfreiheit. Europa braucht eigene große Modelle und Infrastruktur. Bis dahin sollten Firmen nicht auf „das europäische Modell“ warten, sondern mit den heute verfügbaren Systemen arbeiten, mit kommerziellen aber auch mit offenen Systemen. Wichtig ist eine Architektur, die Modellwechsel zulässt. Es gibt bereits europäische Alternativen. Entscheidend ist, wechseln zu können, statt abzuwarten. Infrastruktur ist der zweite Schlüssel. Wenn wir Rechenzentren und „AIGigafactories“ planen, müssen Mittelstand und Verwaltung von Beginn an mit einbezogen werden. Ein niederschwelliger Zugang ist entscheidend. Öffentliche Unterstützung gehört deshalb ins Konzept: Jedoch nicht als Gießkanne, sondern als Zugangsbeschleuniger. Regulierungen wie der AI Act schaffen den notwendigen Rahmen. Entscheidend ist, diesen am Anfang agil auszulegen: Sandboxen nutzen, Erfahrungen sammeln und nachschärfen, wo echte Probleme auftreten. Bürokratie darf nicht zum Selbstzweck werden. Bei der KI-Einführung ist KI-Regulierung selten der Hauptblocker, es mangelt eher an Geschwindigkeit und klaren Andockpunkten.
CONTENTWAY.DE
KI gegen Krebs
Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) kann weitreichende Erfolge vorweisen. Beispielhaft: KI-unterstützte Operationen und Diagnostik.

Antonio Krüger, CEO Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) & Professor für Computer Science an der Universität des Saarlandes
ist, was verlässlich in Prozesse und Produkte überführt wird und dabei hilft, die Fähigkeiten der Teams zu erweitern. Produktentwickler benötigen Kenntnisse im Umgang mit KI-Werkzeugen. Nur, wer das eigene Produkt wirklich versteht, kann KI sinnvoll integrieren. Um ein grundlegendes Verständnis dafür zu entwickeln, muss KI in Schule, Ausbildung und Studium vermittelt werden, als Werkzeug und als Lerngegenstand. Wir brauchen Grundwissen über die Funktionsweise, die Grenzen und den verantwortlichen Einsatz von KI. Übrigens ist es für kein Land möglich, die nötige Skalierung allein zu bewerkstelligen: Wir benötigen Koordination, klare Prioritäten und starke Achsen. Die deutsch-französische Zusammenarbeit bietet sich an,
19./20. November
im Kurfürstlichen Schloss in Mainz
Das Event, das Menschen und Daten verbindet!

Veranstalter:
Jetzt anmelden und Ticket sichern!


„Deutschland wird global nur dann mithalten, wenn es endlich so radikal im Vermarkten wie im Erfinden denkt.“
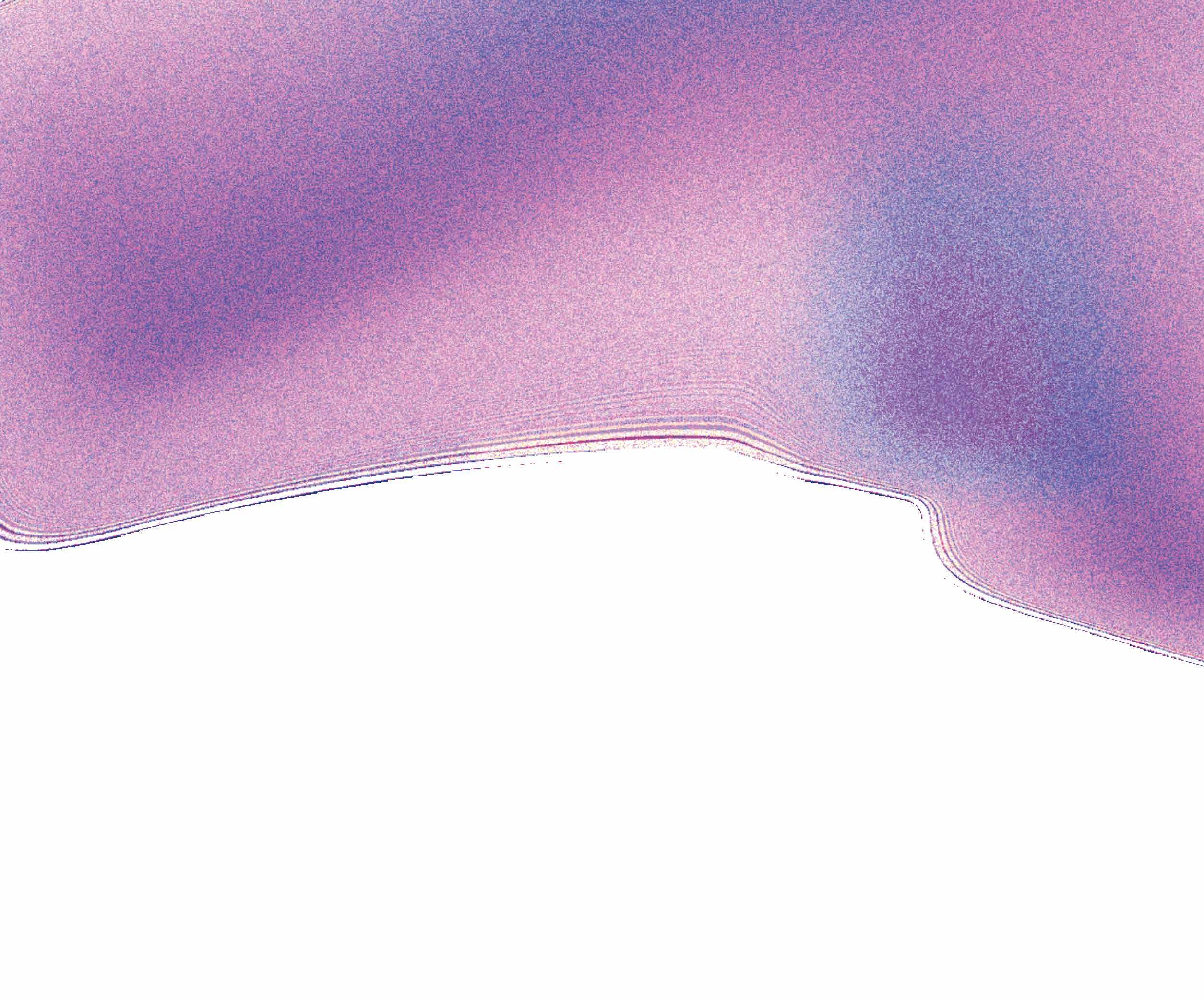
problem. Zu viele Silos zwischen Forschung, Wirtschaft und Regulierung verhindern das Zusammenspiel. Ideen versanden, weil Übersetzer fehlen, die Innovationen in Geschäftsmodelle und Märkte überführen. Und weil Wagniskapital und echte Wachstumsbereitschaft nach wie vor rar sind.
AI als Brennglas für Deutschlands Skalierungsschwäche
Während Deutschland bei Wachstumsfinanzierung, Cloud-Nutzung und KI-Diffusion stockt –nur rund 45 Prozent der Unternehmen nutzen Cloud, gerade einmal 13,5 Prozent setzen KI ein – treiben USA und China die Skalierung konsequent voran.
USA: Customer-First-Mentalität, hohe Cloud-Reife und der Staat als „First Customer“ sorgen dafür, dass Prototypen rasch in Produktion gehen.
China: verzeichnet die stärksten GenAI-Nutzungszuwächse, beschleunigt mit standardisierten Workflows und massiver Industriepolitik die Verbreitung neuer Technologien.
tengründen auf On-Premise-Lösungen –langsam, teuer, innovationsfeindlich. Das Ergebnis: Innovationen bleiben in der Warteschleife.
Von Projekten zu Produkten –Führungskräfte müssen vorangehen Deutschland braucht den Wechsel vom Projekt- zum Produktdenken. AI darf kein Insellabor bleiben, sondern muss industrialisiert werden –mit MLOps, Wiederverwendungsplattformen und souveräner Cloud.
Outcome statt Aufwand: Unternehmen müssen Ergebnisse liefern, keine Stundenzettel. Beschaffung sollte an messbaren Outcomes ausgerichtet sein.
Mindset & Verantwortung: Firmen brauchen klare Go-Live-Quoten und P&L-Verantwortung für AI-Lösungen. Risiko wird mit Standards gemanagt – nicht durch Vermeidung blockiert.
BizTech-Squads als Standard: Gemischte Teams aus AI-Engineers, Product Ownern und Branchenexperten bringen Innovation in die Skalierung.

FRÉDÉRIC MUNCH
CEO Sopra Steria GER & AT
AI-Lösungen aktiv nachzufragen. Adoption entsteht durch Skills, Transparenz und Kennzeichnung.
Politik als Enabler: Ein starkes Digitalministerium kann mit mittelstandstauglicher Infrastruktur, moderner Beschaffung und einem öffentlichen KPI-Board Tempo geben. Aber: Die Verantwortung liegt zuerst bei uns Unternehmen – nicht in Berlin oder Brüssel.
Europa wird nicht an Ideen scheitern, sondern an Konsequenz.
Wenn wir die Skalierungslücke schließen wollen, brauchen wir weniger Leuchttürme und mehr „AI als Produkt“.
Meine Erwartung:
In 100 Tagen zählen Go-Lives statt PowerPoints.
In 12 Monaten skaliert mindestens ein AIProdukt pro Kernbereich.
In zwei Jahren ist Ergebnisverantwortung für AI so selbstverständlich wie Budgetverantwortung.
Das ist machbar. Und es ist überfällig.
Die Logistikbranche steht vor einem Umbruch. Künstliche Intelligenz kann Prozesse beschleunigen, Kosten senken und Klimaeffekte messbar machen. Wie realistisch ist der breite Einsatz – und welche ersten Schritte lohnen sich für Unternehmen? Darüber spricht Dr. Paulina Prantl, Expertin im Bereich Supply Chain Services des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS.
Text: Thomas Soltau Foto: Fraunhofer IIS/Paul Pulkert, Homa Appliances/unsplash
Wo hebt KI heute den größten Nutzen entlang der Wertschöpfungskette?
Eine pauschale Antwort gibt es nicht, denn der Nutzen hängt stark von den Prozessen im Unternehmen ab. Es lassen sich drei Dimensionen unterscheiden. Ökonomisch ermöglicht KI schnellere Abläufe, die Identifikation von Engpässen, effizientere Planung und flexiblere Personaleinsätze. Ökologisch können Energieverbrauch in Lagern und Transportemissionen reduziert werden. Sozial bedeutet KI oft Entlastung und Unterstützung im Alltag.

Dr. Paulina Prantl, Abteilungsleitung „Analytics“, Fraunhofer IIS
Was bremst den breiten Einsatz – und wie löst man es pragmatisch?
Vor allem fehlt Wissen im Umgang mit KI. Hinzu kommen rechtliche Unklarheiten, unzureichende Datengrundlage, inkompatible Systeme, Kosten und Angst vor Arbeitsplatzverlust. Wichtig ist, mit einer klaren Strategie und realistischen Use Cases zu beginnen. Dafür führen wir in der Regel Workshops samt Roadmap und realistischem ROI-Zielbild durch. Jedes Unternehmen tickt anders, deshalb braucht es individuelle Ansätze.
Wie geht man mit lückenhaften Daten um?
Wir setzen auf Data-Centric-Methoden wie gezielte Aufbereitung, Augmentierung oder synthetische Daten.
Kann generative KI operative Entscheidungen unterstützen, ohne zur Blackbox zu werden? Ja, etwa über Retrieval Augmented Ge -

neration, das Antworten mit ge prüften Quellen verknüpft. Explain ableAI-Methoden wie Visualisierungen machen Ergebnisse nachvollziehbar. Aber: Halluzinationen sind möglich. Mitarbeitende müssen geschult werden, Ergebnisse kritisch einzuordnen.
Wie gelingt der Schritt vom Pilotprojekt zum Rollout –auch im Kontext EU-AI-Act?
Im Rollout sind Betriebskonzepte, Zugriffsrechte, Governance und Risikoanalysen entscheidend. In der Logistik gelten nach EU-AI-Act die meisten Use Cases,
AKQUINET – Partner Content
die nicht mit generativer KI arbeiten, als Low Risk, bei breiter Automatisierung steigen jedoch die Anforderungen an Dokumentationspflichten.
Welche Quick Wins empfehlen
Sie dem Mittelstand mit klarem ROI und CO2-Effekt?
Der erste Gewinn ist Entscheidungsfähigkeit: Datenlage prüfen und eine Use-Case-Roadmap erstellen. Operativ bieten sich – je nach Ausgangslage – Routen- und Dispositionsoptimierung an; CO2- und Zeiteffekte sind möglich.
Wer KI sicher und mit Mehrwert nutzen will, muss sie zuerst verstehen.
KI wird aktuell als Antwort auf so ziemlich alles präsentiert: Schnelle Umsatzsteigerung? Mit KI. Effektives Recruiting? Mit KI. Passgenaue Kundenansprache? Mit KI. Doch wenn Unternehmen anfangen, wirklich Antworten mit KI zu suchen, stoßen sie auf Herausforderungen, ob in der Technologie oder der Organisation.
Herr Wuest, Sie begleiten Industrieunternehmen, aber auch Hafen-Terminals und Krankenhäuser bei der Digitalisierung und KIProjekten. Welcher Bereich wird nach Ihrer Einschätzung als erster radikal durch KI verändert? Alle Bereiche werden durch die KI umfassend verändert, meist eher als Evolution. Wer in der mittelständischen Industrie bestehen will, kann auf KIMethoden zur Produktivitätssteigerung und effizienten Verwaltung seines Unternehmens nicht mehr verzichten. Man

denke nur an Instandhaltung, Qualitätskontrolle oder auch KI in Vertrieb und Aftersales. Wir selbst ergänzen gerade auch viele unserer Angebote um KI-Optionen, wie zum Beispiel Agenten zur Datenmigration.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten für den KI-Einsatz. Wie können Unternehmen den richtigen Weg finden?
In unseren KI-Schulungen merke ich immer wieder, dass viele zu Beginn „erschlagen“ sind. Wo soll ich anfangen? Was ist richtig, was falsch? Und wo sind eigentlich die Grenzen von KI? Ich versuche hier immer, zuerst so etwas wie einen KI-Wegweiser zu vermitteln. Das ist ein Basiswissen, wie KI jenseits einer bestimmten Anwendung oder eines Szenarios funktioniert, was sie kann und was zu beachten ist. Mit diesem Wegweiser kann ich erkennen, wo Potenziale zu heben sind und so die eigene KI-Strategie bauen.
Wie weit sind die Unternehmen auf ihrem eigenen KI-Weg?
Der IT-Dienstleister AKQUINET berät zum KI-Einstieg und bietet als Basis für die KI sicheres Colocation für IT-Infrastrukturen aus seinen Rechenzentren. https://akqui.net/ki
Viele Unternehmen haben in Testprojekten ihre ersten Erfahrungen gemacht. Oft stockt die Umsetzung aber wegen schwer anzubindender Systeme oder unzureichender Datenqualität. Und natürlich sind auch Datensouveränität und hier konkret die Datensicherheit ein Hindernis.
Wie können Unternehmen KI sicher und dennoch produktiv nutzen? Fast alle Unternehmen haben Standardlösungen wie von SAP oder Microsoft im Haus. Es liegt nahe, deren für bestimmte Nutzungen bereits trainierte KI-Angebote anzuschauen und zu testen. Das gilt auch für Open-Source-Lösungen. Entscheidend ist aber immer, auf welche Daten die KI zugreifen darf und wie die Ergebnisse geschützt bleiben. Man muss der KI also individuelle Grenzen setzen. Wir beraten und unterstützen bei der Implementierung von KI-Lösungen. Über unsere Rechenzentren bieten wir auch den Betrieb der IT-Infrastrukturen für die KI an, ob in der Public oder Private Cloud oder on Prem.

Entscheidend ist, auf welche Daten die KI zugreifen darf und wie die Ergebnisse geschützt bleiben.

Vom Klemmbrett zur KI: Wie die Luftfahrtindustrie ihre Abläufe neu erfindet.
Flughäfen sind Hochleistungsmaschinen – und der Turnaround ist ihr Herzschlag: Im kurzen Zeitfenster zwischen der Landung eines Flugzeugs und dem Abflug zum nächsten Ziel müssen eine Vielzahl von Aufgaben wie das Ein- und Aussteigen der Passagiere, das Be- und Entladen von Gepäck, die Reinigung, das Betanken sowie Sicherheitschecks perfekt ineinandergreifen. Viele Prozessschritte, die zwar z. T. auch digital ablaufen, hängen weiterhin vom menschlichen Input ab. Vergessene Rückmeldungen sind alltäglich, Informationen werden geschönt, und die tatsächliche Lage erfährt man oft erst am Telefon. Das ist keine Basis für ein wirksames Steering, sondern ein Nährboden für Verzögerungen, die erhebliche Kosten nach sich ziehen und zudem zu Anschlussproblemen und Kettenreaktionen bei anderen Flügen führen. Hier setzt der Bedarf an innovativen KI-Lösungen an: Mit intelligenten Systemen, die die komplexen Abläufe am Boden nicht nur in Echtzeit überwachen, sondern auch vorausschauend steuern können.
Im Gespräch mit Christian Ritter, Head of Product und Manuel van Esch, Geschäftsführer bei zeroG. Die Tochtergesellschaft der Lufthansa Systems entwickelt datengetriebene, KI- und maschinelle Lernlösungen in der Luftfahrt, die Airlines Wettbewerbsvorteile bringen, Kosten senken und Prozesse optimieren.
KI bedeutet mehr als Kostensenkung. Ihr eigentliches Potenzial liegt darin, völlig neue Abläufe und Prozesse zu schaffen, die den Luftverkehr nachhaltig verändern können.
Herr van Esch, Herr Ritter, wo sehen Sie aktuell den größten Hebel, um die Bodenprozesse am Flughafen besser zu gestalten?
Van Esch: Viele Flughafenprozesse sind noch analog, vorhandene digitale Lösungen oft isoliert und nicht vernetzt. Der entscheidende Hebel liegt in der datengetriebenen Transparenz. Dazu kommt die KI, die Datenströme zusammenführt, Muster bzw. Musterabweichungen erkennt und so den Turnaround proaktiv
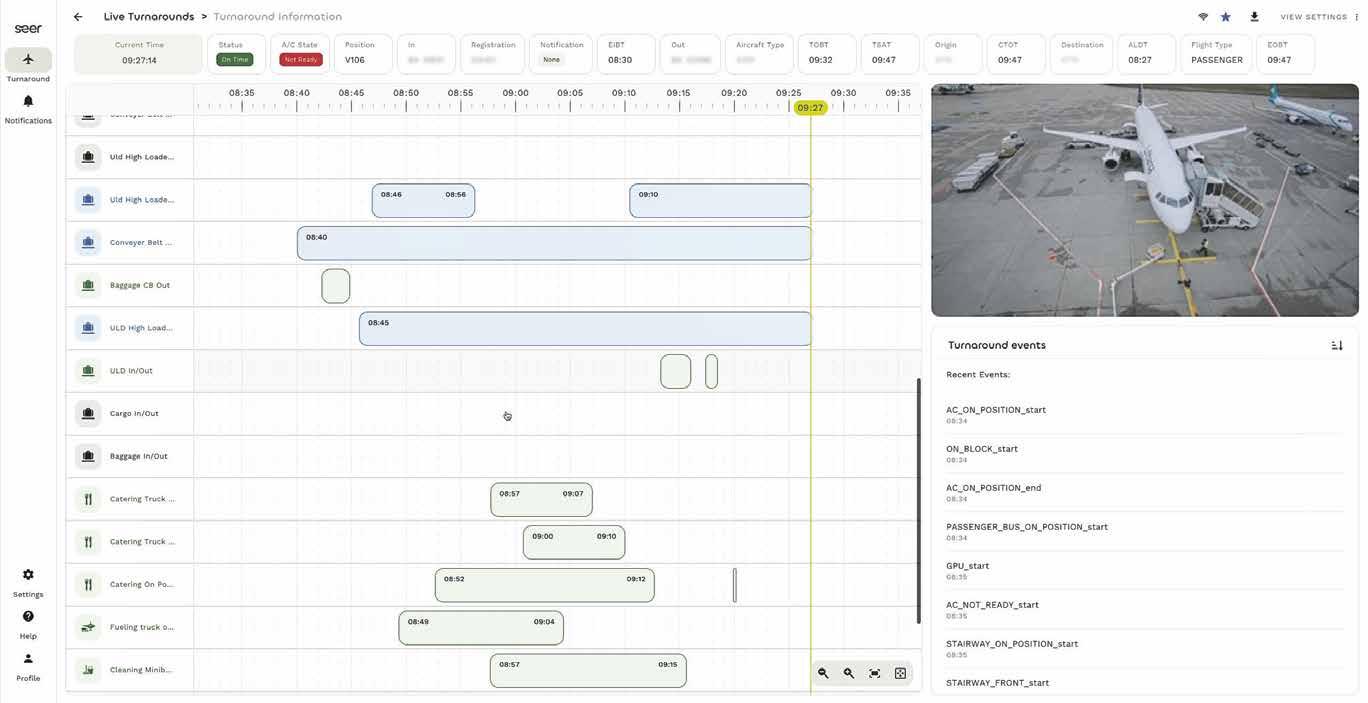
steuern kann. Genau darauf baut unser Projekt „seer“ auf, lokal und einzigartig hier in Hessen entwickelt.
Ritter: Die seer Airport Intelligence Suite, die wir als Lösung zusammen mit dem Flughafen Frankfurt und der Lufthansa-Gruppe entwickelt haben, ist eine kamerabasierte ComputerVision-Lösung, die KI nutzt, um Echtzeitdaten voll automatisiert von Flugzeugpositionen zu erfassen und zu analysieren. Jeder Schritt der Flugzeugabfertigung, vom Andocken der Fluggastbrücke bis zur Gepäckverladung und Betankung, wird von Kameras erfasst. Die KI versieht die Abläufe automatisiert mit Zeitstempeln, sodass ein einheitliches transparentes Lagebild aller Bodenprozesse entsteht. Digitale Assistenten ersetzen fehleranfällige Telefonketten, Ausnahmesituationen werden vorhergesagt und die Prozesssicherheit wird maßgeblich erhöht. Am Flughafen Frankfurt haben wir seer erfolgreich eingeführt und erwarten eine Einsparung von bis zu fünf Minuten pro Turnaround. Durch seer sind Flughäfen der Zukunft nicht mehr auf reaktive Lösungen angewiesen, sondern können operative Herausforderungen proaktiv behandeln und abmindern. Unsere Technologie erlaubt es, dass diese für jeden Flughafen, der seinen Turnaround-Prozess filmen kann – selbst unter suboptimalen Bedingungen, wie niedrig stehende Sonne, Nebel, Vereisungen, Schneefall und Starkregen, funktioniert.
Welche weiteren KI-Initiativen treiben Sie bei zeroG voran, um den Luftverkehr zukunftsfähiger zu machen?
Ritter: Neben Computer-Vision gibt es bei uns weitere Projekte, die sich mit dem Einsatz von KI in der Luftfahrt beschäftigen, wie im Ressourcenma-

nagement oder in der Netzwerkplanung zur besseren Auslastung der Flotte. Über moderne Technologien, wie Reinforcement-Learning-Modelle, schaffen wir Lösungen, um beispielsweise Bodenfahrzeuge, Crews oder Gate-Zuweisungen effizienter zu disponieren.
Van Esch: Heute arbeiten wir mit Observing AI, die Daten sammelt sowie Generative AI, die nicht nur beobachtet, sondern aus diesen Datenergebnissen neues Wissen zu schafft. Aktuell entwickeln wir eine Agentic AI System Intelligence, die den Menschen als Sparring-Partner unterstützt: Sie spielt

Szenarien durch, bewertet Handlungsoptionen und setzt im Rahmen klarer Leitplanken eigenständig Entscheidungen um. Der Mensch behält jederzeit die Kontrolle – er kann eingreifen, Aufgaben delegieren oder bei komplexen Fällen gezielt Feedback geben. Mir ist wichtig zu betonen: KI bedeutet mehr als Kostensenkung. Ihr eigentliches Potenzial liegt darin, völlig neue Abläufe und Prozesse zu schaffen, die den Luftverkehr nachhaltig verändern können. Investitionen sollten daher nicht nur am ROI gemessen, sondern als langfristiger Gewinn für Kunden und Mitarbeitende verstanden werden.
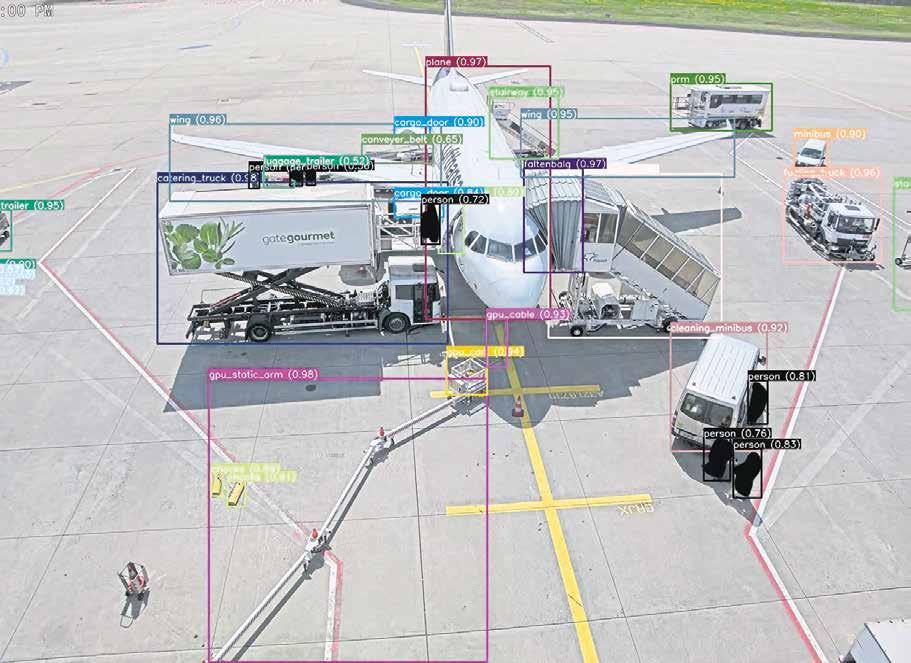
Mit ihren branchenführenden Fähigkeiten, Methoden und Prozessen konzentriert sich zeroG auf die individuellen Bedürfnisse von Fluggesellschaften, unabhängig davon, wo sich das Unternehmen auf dem Weg zu einem datengesteuerten Ansatz befindet. www.zerog.aero
Vom Verwalter zum Gestalter: KI schafft neue Freiräume für strategische Wertschöpfung und individuelle Beratung.
Text: Julia Butz Foto: Sora Shimazaki/pexels
Immer komplexere Regulierungen erfordern höchste Präzision, während gleichzeitig erfahrene Steuer- und Finanzfachkräfte nach und nach in den Ruhestand gehen. Zwar rückt junger Nachwuchs nach, doch die Zahl reicht nicht aus, um den steigenden Bedarf zu decken. Diese Entwicklung stellt Steuer- und Finanzkanzleien vor große Herausforderungen: Einerseits müssen sie mit weniger Arbeitskraft steigenden Anforderungen gerecht werden, andererseits droht, wertvolles Erfahrungswissen verloren zu gehen.
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz beginnt genau dort, wo repetitive und fehleranfällige Aufgaben anfallen. Indem diese Aufgaben automatisiert werden, bleibt Steuer- und Finanzexperten mehr Zeit für die Betreuung der Mandanten und die aktive Mitgestaltung von Zukunftsthemen – und der Beruf selbst gewinnt an Attraktivität: KI ermöglicht
ihnen, sich auf komplexe Fragestellungen zu konzentrieren und innovativ zu agieren; Arbeitsinhalte werden abwechslungsreicher, anspruchsvoller und sinnstiftender. Wer im Job weniger mit monotoner Datenerfassung und mehr mit strategischen Fragestellungen befasst ist, erlebt das Berufsfeld attraktiver und spannender.
Mit dem Ausscheiden erfahrener Fachkräfte droht zudem häufig der Verlust von Erfahrungswerten, die in keiner Datenbank stehen. Künstliche Intelligenz setzt genau hier an. Denn neben der Übernahme zeitaufwendiger Routinearbeiten, liegt ein wesentlicher Vorteil der KI in der Fähigkeit, wertvolles Fachwissen digital zu konservieren und verfügbar zu machen. Informationen, Prozesse und Best Practices werden zentral dokumentiert und ausgewertet, sodass sie nicht allein an einzelne Personen gebunden sind. KI-Systeme, die Workflows, Fälle und Entscheidungen dokumentieren und zugänglich machen, dienen als digitales Gedächtnis. Dadurch reduzieren sich Wissenslücken bei Personalwechseln und die Einarbeitung jüngerer Kollegen wird effizienter. Kanzleien können ihre Expertise langfristig sichern und unabhängig von individuellen Laufbahnen weiterentwickeln

– ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in Zeiten des Fachkräftemangels.
Trotz der Chancen bleiben Fragen offen: Wie transparent und nachvollziehbar sind die Entscheidungen, die KI-Systeme treffen? Woher stammen die Informationen, mit denen die KI ‚gefüttert‘ wurde, auf welche Quellen bezieht sie sich? Was für die generelle Nutzung für private Zwecke gilt, ist für den Finanz- und Steuerbereich für Vertrauen und Compliance entscheidend: Unternehmen, Berater und Behörden müssen sicherstellen, dass KI-gestützte Prozesse überprüfbar bleiben und Datenschutzrichtlinien konsequent eingehalten werden. Wie in vielen anderen Branchen und Tätigkeiten gilt: KI wird auch die Finanz- und Steuerbranche nicht ersetzen, aber sie wird sie grundlegend verändern. Effizienzsteigerung und Fehlerreduktion
gehören zu den sichtbarsten Vorteilen. Noch entscheidender ist jedoch, dass Fachkräfte durch KI unterstützt werden und mehr Zeit für strategische Beratung und komplexe Fälle haben. Damit wandelt sich die Rolle des Steuerberaters wie auch des Finanzexperten – weg vom reinen Verwalter, hin zum Gestalter.
Fakten
75 Prozent der Steuerkanzleien und bis zu 95 Prozent der Großkanzleien setzen KI-Tools bereits ein, vor allem zur Automatisierung von Routineaufgaben und Prozessoptimierung. 94 Prozent der Kanzleien sehen Digitalisierung und KI als Top-Management-Aufgabe.
Quelle: Lünendonk-Studie 2025 „Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung in Deutschland“ (August 2025)
- ADVERTORIAL
Einfach, sicher, aus Deutschland.
Einfach:
Lege mit Krypto los – ganz ohne technische Hürden und mit dem Demo-Modus zum Ausprobieren.
Sicher: Sicherheit »made in Germany« mit allen Lizenzen, ISO-Zertifizierung und mehrstufigem Sicherheitskonzept.
Zuverlässig: BISON ist powered by Boerse Stuttgart Group mit mehr als 160 Jahren Erfahrung und Expertise.
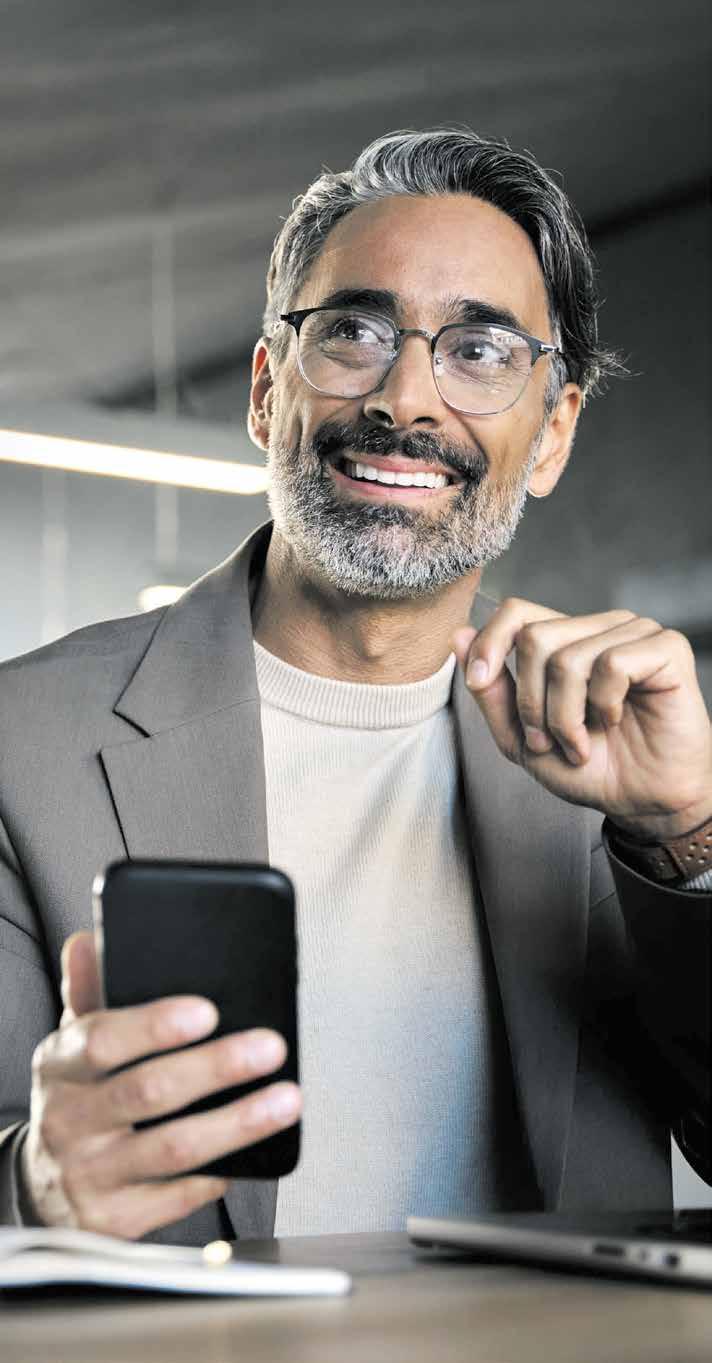
Jetzt kostenlos anmelden:
Generative KI eröffnet vielfältige Anwendungsszenarien für Analyse, Automatisierung und Beratung im Steuerbereich.
Die Ära von ‚Wissen ist Macht‘ neigt sich dem Ende zu. Künstliche Intelligenz (KI) erschließt das Know-how einzelner Mitarbeitenden, macht es unternehmensweit verfügbar und ermöglicht eine intelligente Nutzung. Angesichts Fachkräftemangel und Generationenwechsel ist das von unschätzbarem Wert – für Steuerberater ebenso wie für Mandanten. Denn beide Seiten profitieren von der neuen Transparenz und Effizienz: Mandanten erhalten schneller und gezielter Antworten auf ihre individuellen Fragen, während Steuerberater mehr Zeit für persönliche Beratung gewinnen.
Unser digitaler Assistent gibt Vorschläge für die Erstellung effektiver Prompts oder stellt gezielte Rückfragen, bevor er antwortet.
Die Steuerberatungsbranche steht angesichts dieser Entwicklung vor einem grundlegenden Wandel: Generative KI revolutioniert das klassische Berufsbild und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Beratungspraxis. Neben der Automatisierung von fachlichen Routinetätigkeiten, Buchungsvorgängen oder der Belegerfassung, lassen sich durch KI heute auch wissensbasierte und spezialisierte Fragestellungen erledigen.
So verschiebt sich der Schwerpunkt der Arbeit im Steuersektor zunehmend von standardisierten Prozessen hin zu individueller und strategischer Beratung – unterstützt durch neue intelligente Tools. Selbst komplexe Auswertungen werden durch KI-gestützte Datenanalysen effizienter und damit auch für kleinere Mandate wirtschaftlich tragbar.
Entscheidend für den Erfolg aber ist eine zukunftsfähige KI-Strategie und der Aufbau einer leistungsfähigen KI-Infrastruktur, die in eine geschützte, datenschutzkonforme Umgebung eingebettet ist. „Die Implementierung von KI-Assistenzsystemen in Steuerund Finanzabteilungen bietet ein enormes Potenzial zur Steigerung von Produktivität und Qualität“, sagt Michel Braun, Chief AI Officer beim internationalen Steuerberatungsunternehmen WTS, der gemeinsam mit Stefan Groß einer der beiden Geschäftsführer des 2023 gegründeten Joint Ventures WTS PSP AI GmbH ist. Das Joint Venture betreibt unter der Ägide von WTS Tax AG und PSP München die webbasierte Plattform plAIground, über die sich verschiedene KI-Tools und -Assistenzsystemen direkt ansteuern lassen.
Unter der Botschaft MEET YOUR NEW COWORKERS bringt der plAIground „generative KI praxisnah in den Steuersektor – als intelligenten und sicheren täglichen Helfer, der speziell für die Nutzung sensibler Daten ausgerichtet ist“, erläutert Stefan Groß.




Tax-Chatbots beantworten steuerliche Fragestellungen, KI-Agenten übernehmen die Dokumentenanalyse, -zusammenfassung und -übersetzung von Texten, Websites oder Richtlinien. Durchdacht ist auch der Prompting Assistent, der bei der Interaktion mit dem plAIground unterstützt. „Nur wer richtig fragt, bekommt auch die Antworten, die er für ein valides steuerliches Ergebnis braucht. Unser digitaler Assistent gibt Vorschläge für die Erstellung effektiver Prompts oder stellt gezielte Rückfragen, bevor er antwortet“, sagt Michel Braun. Kombiniert ist der plAIground mit qualitätsgesichertem Expertenwissen und steuerlichem Content aus dem Otto Schmidt Verlag – Fachquellen, mit der Nutzung der Taxy.io-KI, zukünftig Quellen vom NWB Verlag und von der Tax Academy von Prof. Dr. Kessler, auf die Steuerberater klassischerweise in ihrer täglichen Arbeit zurückgreifen.
Ein weiteres zentrales Element ist die Aus- und Weiterbildung: „Nur wer versteht, was mit KI möglich ist, kann sie auch erfolgreich nutzen“, so Michel Braun. Mit dem AI Campus hat WTS PSP AI GmbH ein spezielles Ausbildungskonzept entwickelt, das praxisnah vermittelt, wie KI im Steuerbereich eingesetzt werden kann.
WTS, als größte Steuerberatung nach den Big 4, verfolgt das Ziel, ihren Mandanten ein ganzheitliches AI Ecosystem bereitzustellen. Neben dem plAIground umfasst dieses weitere Bausteine, die gezielt auf die Anforderungen im Steuerbereich zugeschnitten sind. „Es gibt zahlreiche KI-Methoden, die sich für steuerliche Aufgaben eignen. Für jede Aufgabe muss geprüft werden, welche Technologie den größten Mehrwert bietet. Wer intelligente Lösungen einsetzen möchte, braucht dafür strategische Planung und ein solides Fundament“, erklärt Michel Braun.
Um den individuellen KI-Bedarf zu ermitteln und Mandanten AI Ready zu machen, bietet WTS sogenannte Discovery Workshops an. Darauf aufbauend unterstützt WTS bei der Umsetzung konkreter Anwendungsfälle – vom Proof of Concept bis zum fertigen Produkt.
Wer intelligente Lösungen einsetzen möchte, braucht dafür strategische Planung und ein solides Fundament.


Mit einem Testament oder Erbvertrag legen Sie nicht nur fest, dass Ihr Letzter Wille umgesetzt wird. Durch steuerliche Vorteile bewirken Sie zudem über den Tod hinaus Gutes.
Mit Gedanken über den eigenen Tod setzt sich vermutlich niemand gern auseinander. Und doch ist es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Mit einer Letztwilligen Verfügung unliebsame Folgen vermeiden
Wer kein Testament schreibt, läuft Gefahr, dass Personen erben, denen man eigentlich nichts hinterlassen möchte. Denn ohne Testament greift die gesetzliche Erbfolge – und diese ist oft nicht jedem klar. Dann erben die nächsten Angehörigen, meist Ehepartner und eventuell Kinder, und danach Eltern und Geschwister. In einer nicht-ehelichen Partnerschaft sind dagegen weder Partnerin noch Partner erbberechtigt. Gibt es gar keine Angehörigen, fällt das gesamte Erbe an den Staat.
Wer sich langsam dem Ruhestand nähert, sollte eine juristisch wasserdichte Nachfolge planen, denn bei einer Unternehmensvererbung ist eine frühzeitige und klare Planung entscheidend. Zunächst sollte unbedingt ein Testament oder Erbvertrag erstellt werden, da sonst die gesetzliche Erbfolge greift und eine Erbengemeinschaft entsteht, was häufig zu Konflikten führt.
Um die Kontinuität des Unternehmens zu sichern und steuerliche Vorteile optimal zu nutzen, empfiehlt es sich, die Nachfolgeplanung frühzeitig – am besten mehrere Jahre im Voraus – gemeinsam mit Notar, Steuerberater und gegebenenfalls durch Anpassung des Gesellschaftsvertrags vorzubereiten.
Mit steuerlichen Vorteilen doppelt punkten
Möchte man sicher gehen, dass sein Herzensprojekt auch zukünftig finanziert wird, kann man unterschiedliche Wege wählen. Wer zum Beispiel sein Vermächtnis einer gemeinnützigen Organisation wie der Christoffel-Blindenmission (CBM) hinterlässt, punktet doppelt. Zum einen sind gemeinnützige Organisationen von der Erbschaftssteuer befreit. Zum anderen bewirkt das Vermächtnis über das eigene Leben hinaus Gutes: Es verhilft Menschen mit Behinderungen z. B. in Afrika zu einer besseren Zukunft. Bereits

seit mehr als 115 Jahren sorgt die CBM gemeinsam mit ihren lokalen Partnern dafür, dass sich das Leben von Menschen mit Behinderungen grundlegend und dauerhaft verbessert. Beispielsweise erhalten blinde und sehbehinderte Menschen eine lebensverändernde Augenoperation, Kindern wird der Schulbesuch ermöglicht, und es können dringend benötigte Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden.
Stiften, Gutes tun und steuerlich entlasten Wer stifterisch aktiv wird – etwa über die CBM Stiftung – kann seine Werte langfristig weitergeben und gleichzeitig Erbinnen und Erben steuerlich entlasten.
Mit der CBM Stiftung bietet die CBM vielfältige Möglichkeiten für stifterisches Engagement. Für Erblasserinnen und Erblasser bedeutet das: Sie können ihr Vermächtnis individuell gestalten – etwa durch Zustiftungen, einen Stiftungsfonds oder eine eigene Stiftung unter dem Dach der CBM Stiftung. Für Erbinnen und Erben bietet stifterisches Engagement über die CBM Stiftung die Chance, Erbschaftssteuer zu vermeiden und gleichzeitig sinnstiftend zu handeln.

Vererben, stiften, Gutes tun
Haben Sie Fragen zu Vermächtnissen und Stiftungen?
Sprechen Sie uns gern an.

Alexander Lauber
Telefon: (06251) 131-145
E-Mail: legate@cbm.de

Alexander Mink
Telefon: (06251) 131-333
E-Mail: info@cbm-stiftung.de
Mehr Infos unter www.cbm.de/vererbenstiften oder den QR-Code scannen

Global Business Services wandeln sich vom Kostenblock zum Taktgeber. KI-Agenten übernehmen Routinen, schaffen Transparenz in Echtzeit und geben CFOs neue Handlungsfreiheit.
2025 steht die Finanzorganisation am Wendepunkt. Global Business Services (GBS) sind längst nicht mehr nur Kostensenker. Sie entwickeln sich zu einem strategischen Motor, der Geschwindigkeit, Datenqualität und Compliance zugleich liefert. Der Hebel dafür sind KI-Agenten. Sie arbeiten wie digitale Kolleginnen und Kollegen, die Standardaufgaben eigenständig erledigen und jede Entscheidung protokollieren. CFOs gewinnen so einen ganz neuen Blick: Statt nachlaufender Reports erhalten sie laufende Empfehlungen, die Risiken früher sichtbar machen und Liquidität planbarer gestalten. Damit verändert sich die Rolle von Finance grundlegend. Aus einem transaktionalen Backoffice wird ein intelligentes Nervenzentrum, das Märkte, Lieferketten und Cashflows in Echtzeit spiegelt. Doch die Technologie ist nur ein Teil.
Für große Volumina zählen robuste Standardplattformen. Sie bringen Sicherheit, Integration und Skalierbarkeit mit, senken Betriebskosten und halten Prüfungen stand.
Ebenso wichtig sind Governance, einheitliche Daten und neue Rollen: vom Supervisor für Agenten über Coaches für Prompting bis zum Product Owner für Prozesse. Wer früh startet, setzt hier Standards – und verschafft sich einen Vorsprung. Uli Erxleben, Gründer und Geschäftsführer von Hypatos, erklärt, wie GBS der Zukunft konkret aussieht. Das Berliner Unternehmen Hypatos entwickelt KI-Agentensysteme für Global Business Services und gilt als Pionier auf diesem Gebiet.
Herr Erxleben, wie sieht GBS der Zukunft aus?
Es entwickelt sich vom Abwickler zum Wertschöpfungspartner. KI-Agenten übernehmen Routinen, Menschen konzentrieren sich auf Szenarien, Forecasting und Working Capital. Standardprozesse laufen Ende zu Ende durch – mit Auditspur, klarer Begründung und sofort nutzbaren Insights. CFOs erleben dadurch etwas Neues: ein Finanzbereich, der nicht reagiert, sondern agiert. Continuous Close rückt näher, Entscheidungen werden schneller und sicherer.
Was bedeutet das konkret für Finance-Prozesse?
Ein Agent liest Rechnungen aus, gleicht Daten ab und bucht direkt. Im Order-to-Cash überwacht er Zahlungen, erstellt Mahnungen und beantwortet Standardanfragen. Im Reporting bereitet er Abgleiche vor und markiert Abweichungen, bevor sie zu Risiken werden. Alles läuft dokumentiert, alles ist nachvollziehbar. Das Team greift nur ein, wenn es wirklich
Hypatos ebnet den Weg in eine Zukunft, in der KI Geschäftsprozesse beschleunigt und Menschen befähigt, fundierte Entscheidungen zu treffen und Innovationen voranzubringen. www.hypatos.ai
zählt. So entsteht ein digitaler Betrieb, der rund um die Uhr läuft – und für CFOs eine Organisation, die jederzeit in Echtzeit steuerbar bleibt.
Wie gelingt konkret der Wandel in Unternehmen?
Es braucht Governance und neue Skills. Ein Center of Excellence definiert Regeln, Policies und Monitoring. Gleichzeitig wachsen neue Rollen: Supervisor für Agenten, Coaches für KI-Erklärbarkeit, Product Owner für Prozesse. Mitarbeitende werden „upgegradet“, lernen, mit Agenten zu interagieren und ihre Ergebnisse zu validieren. Jede Entscheidung trägt eine Begründung für den Audit, kombiniert mit Vier-Augen-Prinzip und Eskalationswegen. So entsteht Vertrauen –nach innen wie nach außen.
Welche Plattformstrategie trägt in Zukunft?
Für große Volumina zählen robuste Standardplattformen. Sie bringen Sicherheit, Integration und Skalierbarkeit mit, senken Betriebskosten und halten Prüfungen stand. Ergänzende Eigenentwicklungen sind dort sinnvoll, wo Differenzierung Wettbewerbsvorteile schafft. Wichtig sind offene Schnittstellen zu E-Mail, DMS und ERP, dazu ein Rechtekonzept bis auf Feldebene. Entscheidend ist weniger die Frage Build oder Buy, sondern: Schaffe ich eine Plattform, die End-toEnd denken kann, wie die Lösungen von Hypatos.
Wie startet man messbar schnell? Mit einem klar abgegrenzten Use Case,

Dr. Uli Erxleben, Gründer und Geschäftsführer von Hypatos
Jede Entscheidung trägt eine Begründung für den Audit, kombiniert mit Vier-Augen-Prinzip und Eskalationswegen. So entsteht Vertrauen – nach innen wie nach außen.
typischerweise in Accounts Payable. Prozesse werden modelliert, Arbeitsanweisungen präzisiert und Systeme angebunden. Im User-Acceptance-Test prüfen Fachkräfte Ergebnisse, ergänzen Regeln und schließen Lücken – in vier bis sechs Wochen. Danach folgt Hypercare mit messbaren KPIs für Durchlaufzeit und First-Pass-Yield. Parallel entsteht der Business Case, begleitet von Stakeholdern aus Finance, Einkauf und IT. Nach dem Pilot wird konsequent skaliert – über Länder, Sprachen und Belegarten. Als Visionär mit Weitblick bietet Hypatos Unternehmen eine Plattform, die Routinen zuverlässig automatisiert und den Weg in das GBS der Zukunft ebnet.

GROSSES INTERVIEW
Europa hat zwar keine Big-Tech-Plattformen, aber sehr starke Industrien. Peter Sarlin, führender Experte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Co-Founder und CEO von AMD SILO AI, ist fest davon überzeugt, dass europäische Unternehmen führend im Bereich der KI werden können – wenn sie jetzt mutig investieren.
Text: Katja Deutsch
Foto: Presse
Peter, unter deiner Führung hat sich SILO AI zu Europas größtem privaten KI-Labor entwickelt, mit über 300 Mitarbeitenden, von denen die meisten promoviert sind. Welches Führungsprinzip hat euch in einem so dynamischen Technologiefeld so stark wachsen lassen?
Für mich kommt gute Führung aus der Wertebasis und der Kultur, die man gemeinsam aufbaut. Die Art, wie ich die SILO-Wertebasis und die SILO-Kultur zusammenfasse, ist – auf verschiedene Weise – ehrgeizig und demütig. Ehrgeiz bedeutet, dass ich anspruchsvoll bin und hohe Ziele setze. Demut bedeutet für mich als Gründer und Unternehmer aber auch, selbst mit anzupacken, Verantwortung zu teilen, die notwendige Arbeit zu leisten und Seite an Seite mit dem Team zu arbeiten.
Überall heißt es, dass KI den Menschen in fast allen Branchen ersetzen könnte. Gleichzeitig betonst du, wie wichtig es ist, den Menschen ins Zentrum zu stellen, wenn man KI baut. Was genau meinst du damit? Ich habe immer an menschenzentrierte KI geglaubt, oder, wie wir es nennen: AI for people. Seit 2007 arbeite ich mit
KI, und seitdem hat sich die Technologie enorm entwickelt. Doch auch, wenn Modelle heute beeindruckende Fähigkeiten haben, sind wir weit entfernt von „Superintelligenz“, die jede Aufgabe wie ein Mensch erledigt. Für mich steht daher die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen im Mittelpunkt. Entscheidend ist für mich, wie sie in Produkte integriert wird, sodass sie echten Mehrwert für Menschen schafft, sei es in Autos, Handys, Suchmaschinen oder KI-Assistenten.
Wird KI nicht gerade ihre eigenen Schöpfer zuerst ersetzen?
Meine Antwort ist: Nein. Oder besser gesagt: Ja, aber nein (lacht). KI schafft enormen Wert in kreativen Tätigkeiten, und das sage ich seit vielen Jahren. Generative Technologien erweitern unsere Fähigkeiten, fast wie „Superkräfte“. Natürlich verändert das den Arbeitsmarkt. Wir müssen lernen, diese Werkzeuge klug einzusetzen, doch auch schon vor 25 Jahren mussten wir lernen, mit PCs umzugehen. Ich glaube an flexible Arbeitsmärkte, die sich neuen Technologien anpassen. Aber es ist ein großer Wandel, vor allem in der Frage, wie wir Kreativität lernen und lehren. Junge Menschen wachsen mit KI auf, aber sie brauchen trotzdem die Fähigkeit, Kreativität von Grund auf zu entwickeln.
Wie überbrückst du die Kluft zwischen exzellenter Forschung und marktreifen Produkten?
Sehr gute Frage. Von Anfang an war mir akademische Exzellenz wichtig: Bei SILO haben wir 300 KIWissenschaftler und Ingenieure, aber unser Ziel war immer reale Wirkung. Dafür braucht es Menschen, die nicht nur theoretisch denken, sondern die härtesten Industrieprobleme lösen und KI in Produktion bringen. Forschung
verschiebt Grenzen, aber im Markt gewinnt, wer schnell Produkte liefert, Feedback einholt und sich anpasst.
Was bedeutet „digitale Souveränität“ für dich konkret? Und wie realistisch ist es, dass Europa unabhängig von den USA und China wird? Souveränität heißt für mich, volle Kontrolle und Eigentum über kritische Technologien. Europa hat keine großen Plattformen wie die USA oder China, doch bei KI geht es auch um die Modelle selbst. Wir brauchen offene Modelle, die europäische Werte und (auch kleine!) Sprachen abbilden. Deshalb haben wir in Europa Initiativen wie Poro, Viking, Europa und jetzt Open Euro gestartet. Das ist entscheidend, damit europäische Unternehmen volle Kontrolle über ihre KI haben.
Wie kann KI echten Wert für Wirtschaft und Gesellschaft schaffen? Als Ökonom sehe ich den Wert von KI in Produktivität. Sie steigert Effizienz und damit Wohlstand. Manche bauen die Technologien, andere nutzen fertige Produkte, doch am Ende profitieren die Endnutzer durch Produktivitätsgewinne.
Yuval Noah Harari warnt, dass KI uns in wenigen Jahren dominieren und versklaven könnte. Übertreibt er?
Ich denke, das ist eine philosophisch wichtige Diskussion über Superintelligenz. Aber aktuell sind wir nicht dort. Natürlich birgt KI Risiken, so wie jede Technologie. Deshalb sind klare, bereichsspezifische Regulierungen nötig. Trotzdem glaube ich, dass uns KI mit den richtigen Regeln weitaus mehr hilft als schadet.
Was ist dein persönlicher positiver Ausblick für die nächsten zehn Jahre mit KI?
Ich mache das, weil ich leidenschaftlich an KI interessiert bin, und jetzt sehe ich, wie KI in großem Maßstab die Praxis erreicht. Sprachmodelle sind nur der Anfang, auch in Life Sciences, Automobil, Chemie, Robotik, Gaming, Materialwissenschaften und sogar bei Wettermodellen gibt es enorme Fortschritte. Für Europa liegt hier eine riesige Chance: Wir haben keine Big-Tech-Plattformen, aber starke Industrien, und wenn wir mutig in KI-Infrastrukturen investieren, können wir führend sein. Das ist die positive Vision, die ich sehe.
Sprachmodelle sind nur der Anfang, auch in Life Sciences, Automobil, Chemie, Robotik, Gaming, Materialwissenschaften und sogar bei Wettermodellen gibt es enorme Fortschritte.
Peter Sarlin…
• Langstreckenlauf, wie z. B. ein Halbmarathon auf eigene Faust, ist für ihn am Wochenende ein Vergnügen – wenn es die Zeit erlaubt
• Kauft als Hobby antike Möbel und Kunst
• Bevorzugt Schwarz in seiner Kleidung – und wenn er es mal richtig wild treibt, trägt er Weiß oder Grau
• Ein eigener Spruch fasst ihn gut zusammen: „Arbeit macht mehr Spaß als Spaß. – Work is more fun than fun.“
Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Treiber für Innovationen und Effizienz in Unternehmen entwickelt. Durch den Einsatz von KI-Technologien wie maschinellem Lernen, Sprach- und Bilderkennung sowie datenbasierter Unterstützung bei Entscheidungen können Unternehmen Prozesse automatisieren, Entscheidungsfindungen optimieren und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Die Potenziale reichen von der Verbesserung der Kundeninteraktion über präzisere Prognosen für die Produktion bis hin zur intelligenten Analyse großer Datenmengen.
Gleichzeitig stehen Unternehmen beim Einsatz von KI vor erheblichen Herausforderungen. Dazu zählen technologische Hürden bei der Integration von KI-Lösungen in bestehende Systeme, die Sicherstellung von Datenqualität und Datenschutz sowie die ethische Verantwortung bei automatisierten Entscheidungen. Die strategische Implementierung von KI erfordert daher eine sorgfältige Planung, die kontinuierliche Schulung der Mitarbeitenden und eine kritische Reflexion über den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss dieser Technologien.
Alan Flower ist Leiter der AI-Labs bei HCLTech. Er leitet die sechs globalen AI & Cloud Native Labs und treibt dort Innovationen sowie strategische Partnerschaften voran. Er unterstützt Unternehmen dabei, mit modernen KI-Lösungen ihre Geschäftsprozesse weiterzuentwickeln und neue Potenziale zu erschließen.
Alan, aus welchen Branchen kommen die Firmen, die bei HCLTech Unterstützung bei ihrer KI-Entwicklung suchen? Was wir derzeit aus der Perspektive unserer weltweit sechs AI-Labs sehen, ist, dass die KI-getriebene Transformation in allen Branchen an Fahrt gewinnt. Besonders dynamisch zeigt sie sich im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der Fertigung, bei Konsumgütern sowie bei Banken und Versicherungen. Überraschend schnell haben sogar eher „langsame“ Branchen wie Energie- oder Wasserversorger reagiert. HCLTech hat bereits über 700 KI-Projekte realisiert und mehr als 500 Kunden begleitet. Von dieser Erfahrung können Unternehmen profitieren, die ihre eigene Transformation vorantreiben wollen.
Welche spezifischen Herausforderungen oder Bedürfnisse haben diese? Unternehmen brauchen zunächst eine stimmige Daten- und Cloud-Strategie sowie eine geeignete Infrastruktur. Wir helfen ihnen, die Möglichkeiten von KI konkret zu verstehen und zu bewerten. Viele setzen KI bereits ein und verzeichnen erste Verbesserungen bei Produktivität, Effizienz und Qualität. Führungskräfte haben meist eine
klare Vision. Wir übersetzen diese in eine realisierbare Roadmap mit messbarem ROI.
Wie hilft HCLTech Unternehmen dabei, diese Visionen in konkrete Projekte umzusetzen?
HCLTech verfügt über eine Full-StackKI-Kompetenz – von Halbleitern und Hardware-Engineering über Infrastrukturen und Foundation Models bis hin zu Plattformen, Anwendungen und Beratung. Oft wissen Unternehmen, was sie erreichen möchten, tun sich aber mit der Umsetzung schwer. In unseren Labs zeigen wir konkrete Anwendungsfälle und setzen diese anschließend mit beschleunigtem Solution Engineering um. So lassen sich Ergebnisse, die früher Monate oder Jahre brauchten, heute in wenigen Wochen erzielen.
Wie wichtig sind Open-SourceTechnologien und Standards für nachhaltige KI-Strategien?
Sehr wichtig. Unternehmen erwarten Flexibilität bei der Integration unterschiedlicher Lösungen, und OpenSource-Ansätze erleichtern dies. Wir entwickeln Anwendungen sowohl mit proprietären als auch Open-Source-
Modellen von Anbietern wie OpenAI, AWS, Google und Meta. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf „agentischer KI“, also autonomen Agenten, die mit Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Offene Standards wie das Agent-toAgent-Protokoll (A2A) sind entscheidend, damit Lösungen verschiedener Anbieter nahtlos zusammenspielen.
Wie helfen Partnerschaften dabei, Ziele schneller zu erreichen?
Eines habe ich früh in meiner Karriere gelernt: Wer schnell sein will, muss Partnerschaften eingehen. Das gilt besonders im Bereich KI. Dank enger Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Google, NVIDIA oder OpenAI haben wir frühzeitigen Zugang zu neuen Technologien und können diese zügig in Projekten einsetzen. Das verschafft unseren Kunden einen klaren Vorteil. In Kombination mit unserer Erfahrung aus hunderten KI-Projekten setzen wir neue Lösungen schneller und zielgerichteter um.
Welchen Rat würden Sie CEOs geben, die eine KI-Transformation vorantreiben?
KI ist keine reine Technologiefrage, sondern eine Aufgabe für das gesamte

Erfolgreiche CEOs konzentrieren sich auf Prozesse mit dem größten Einfluss auf Umsatz und Wachstum, insbesondere in Vertrieb und Marketing, wo KI die Conversion Rate steigern und Ergebnisse messbar verbessern kann.
Unternehmen. Erfolgreiche CEOs konzentrieren sich auf Prozesse mit dem größten Einfluss auf Umsatz und Wachstum, insbesondere in Vertrieb und Marketing, wo KI die Conversion Rate steigern und Ergebnisse messbar verbessern kann. Gleichzeitig müssen Leitplanken für verantwortungsvolle KI und Datenschutz gesetzt werden. Die Entwicklung beschleunigt sich spürbar. CEOs sollten jetzt handeln und KI zum Kern ihrer Unternehmensstrategie machen.


Supercomputer sind keine Zukunftsvision, sondern längst Realität. Sie helfen beim Entschlüsseln des Klimas, beim Entwickeln neuer Medikamente – und treiben die Künstliche Intelligenz an. Europa baut dafür eine MilliardenInfrastruktur auf.
Die Welt ist voller Daten – und damit auch voller Fragen, die ohne extreme Rechenpower unbeantwortet bleiben. Was passiert im Inneren einer Turbine? Wie entwickelt sich das Klima in den nächsten Jahrzehnten? Warum wirkt ein Medikament genau so und nicht anders? Klassische Rechner stoßen hier an ihre Grenzen. Lange lag die Vormachtstellung bei den USA und in Asien. Europa aber will sich nicht dauerhaft auf fremde Kapazitäten verlassen. Es geht um mehr als Tempo und Rechenrekorde: gefragt sind Präzision, Energieeffizienz und die Fähigkeit, neue Technologien wie Quantencomputer einzubinden. Dahinter steckt auch ein Stück Standortpolitik und digitale Souveränität. Mit dem neuen Exascale-System am Forschungszentrum Jülich ist nun ein Rechner in Betrieb, der all das leisten soll. Prof. Thomas Lippert, Direktor des Jülich Supercomputing Centre, erläutert, welche Chancen „JUPITER“ eröffnet.
Europa muss die Basistechnologien selbst bauen und betreiben, um Souveränität und ausreichende Rechenzeit zu sichern.
Herr Professor Lippert, warum braucht Europa eigene Exascale-Rechner?
Ohne eigene Maschinen verlieren wir wissenschaftlich und wirtschaftlich den Anschluss. Rechnen bei Hyperscalern reicht nicht: Es ist teuer, Daten liegen außerhalb der EU-Kontrolle, und in der Wertschöpfungskette fehlt Know-how. Europa muss die Basistechnologien selbst bauen und betreiben, um Souveränität und ausreichende Rechenzeit zu sichern.
Wo sehen Sie den größten Nutzen von JUPITER – in Forschung oder Industrie?
In beiden. Simulation bleibt zentral, KI kommt als datengetriebenes Modellieren hinzu. Davon profitieren Wissenschaft, Unternehmen und öffentliche Verwaltung gleichermaßen – bis hin zum Umgang mit Verordnungen und Publikationen. JUPITER wird als Vorreiter für große Modelle überall Wirkung entfalten; hinderlich sind eher regulatorische Hürden.
Was bringt die modulare Architektur konkret?
Modularität prägt JUPITER auf allen Ebenen. Die Rechenzentren selbst bestehen aus vorgefertigten Containern, die hohe Qualitätsstandards sichern. Innerhalb dieser Einheiten lassen sich Hardware-Komponenten flexibel austauschen, während die Software über klar definierte Schnittstellen verfügt. Auf Systemebene verbindet ein gemeinsames Hochgeschwindigkeitsnetzwerk die Module zu einem einheitlichen Adressraum. So greifen spezialisierte Einheiten nahtlos ineinander und ergänzen sich in ihrer Leistung. Künftig wird sich die Architektur dynamisch je nach Aufgabe konfigurieren lassen –mit der passenden Mischung aus CPU, GPU, Booster oder Cluster. Das macht JUPITER zum Modell eines „Computer Center of the Future“.
Kann JUPITER beim Training großer KI-Modelle den Unterschied machen? Ja. Ein Mixture-of-Experts-Modell mit etwa einer Billion Parametern ist in rund drei Monaten trainierbar. Europäische Ansätze wie die des französischen KI-Start-ups Mistral senken den Trainings-Aufwand deutlich bei gleicher Qualität. JUPITER verfügt über zehntausende eng gekoppelte Prozessoren und kann damit das KITraining zusätzlich beschleunigen.


Luftaufnahme des Jülicher Campus mit Modular Data Centre (ganz links), in dem JUPITER untergebracht ist.

Prof. Thomas Lippert, Direktor des Jülich Supercomputing Centre
Wie passt die Leistung zu Nachhaltigkeit?
JUPITER läuft im Regelbetrieb bei etwa 10 Megawatt – gemessen an der Leistung effizient. Der Strom wird äquivalent grün beschafft. Abwärme wird zum Heizen genutzt; ein Projekt zur Stromerzeugung aus Niedertemperatur-Abwärme läuft. Höhere Kühlmittel-Temperaturen versprechen künftig zusätzliche Effizienzgewinne.
Wie kommen Unternehmen –auch der Mittelstand – an JUPITER? Es gibt ein Industry-Relations-Office und etwa 30 Industrieprojekte. Mit der JUPITER AI-Factory „JAIF“, entstehen Services, um Modelle zu nutzen und zu entwickeln; Ziel sind in ein bis zwei Jahren rund 100 Projekte mit
In der Wirtschaft geht es um eigene Methoden und Produktionsmittel, damit Wertschöpfung in Europa bleibt. Nötig sind klare Ziele und der Wille, Großes zu bündeln, statt Mittel zu verstreuen.
KMU. Der Weg ist teils steinig, weil die Nutzung öffentlicher Maschinen durch Firmen regulatorisch komplex ist – hier soll „JAIF“ die Rampe sein.
Wofür steht JUPITER strategisch? Für Wissenschaft gilt: Komplexe Systeme lassen sich ohne solche Maschinen nicht erforschen; JUPITER macht diese Methodik erst möglich. In der Wirtschaft geht es um eigene Methoden und Produktionsmittel, damit Wertschöpfung in Europa bleibt. Nötig sind klare Ziele und der Wille, Großes zu bündeln, statt Mittel zu verstreuen. Die klare Vision: Souveränität und Innovation.

Blick in einen der insgesamt sieben IT-Räume für Racks des JUPITER-Boosters.
Mit JUPITER ist am Forschungszentrum Jülich der erste europäische Supercomputer der Exascale-Klasse am Start. „Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research“, kurz JUPITER, wird als erstes System in Europa eine Rechenleistung von mehr als einer Trillion Rechenoperationen pro Sekunde erreichen. www.fz-juelich.de
Die drei Hauptbarrieren in KI-Projekten
1. Fragmentierter Ansatz
+ Isolierte Pilotprojekte ohne Bezug zur Unternehmensstrategie
+ Generische Modelle ohne klaren Business-Fit
der Unternehmen haben Schwierigkeiten, den Geschäftswert von KI nachzuweisen 49%
2. Lücken in der Umsetzung
Fehlende Integration in bestehende Prozesse und Workflows Fachkräftemangel und Abhängigkeit von Technologieanbietern (Vendor-Lock-in)
Unstrukturierte oder isolierte Datenbestände
der Unternehmen berichten über Reibungen bei Workflows und Integration 43%
3. Hürden bei der Skalierung
+ Ergebnisse sind nicht mit klaren KPIs verknüpft und bleiben schwer messbar
+ Fehlende Governance-Strukturen und einheitliches Operating Model
der Unternehmen vermissen klare Governance und Vertrauensmechanismen ~61%
„Es geht um Intelligenz im Allgemeinen“
Ein aktueller MIT-Bericht zeigt: 95% der Pilotprojekte mit generativer KI scheitern. Auch andere Studien belegen, dass 70-90% aller KI-Initiativen nicht skalieren. Liegt das Problem an der KI selbst –oder daran, wie wir versuchen, sie einzusetzen?
Jede Organisation trägt ungenutzte Intelligenz in sich – in ihren Daten und Dashboards, im Urteilsvermögen der Mitarbeitenden, im über Jahrzehnte gewachsenen Erfahrungswissen und in Prozessen, die den Betrieb am Laufen halten. Diese Intelligenz ist ihr wertvollstes Kapital. Doch sie bleibt oft in Silos eingeschlossen, in starren Workflows vergraben oder geht im operativen Rauschen unter. Die KI-Revolution verspricht Transformation. Aber warum sollte man zerstören, was das Unternehmen einzigartig macht?
Leistung steigern durch gezielte Intelligenznutzung
Der entscheidende Hebel liegt nicht allein in der Technologie, sondern in der Art, wie KI in bestehende Strukturen einge-bettet wird. Erfolgreiche Initiativen verbinden die Intelligenz der Mitarbeitenden („Human Intelligence“), das unternehmensweite Prozesswissen („Enterprise Intelligence“) und die verfügbaren Daten („Data Intelligence“) mit adaptiven KI-Modellen („Artificial Intelligence“).
Statt isolierter Experimente entstehen so Anwendungen, die reale Geschäftsprobleme lösen, Abläufe beschleunigen und Entscheidungen fundierter machen. Ein zentraler Vorteil: Mit einem klar strukturierten Ansatz lassen sich Ergebnisse in Quartalen statt Jahren erzielen.
Organisationen, die diesen Ansatz verfolgen, berichten von rund 20% Produktivitätssteigerung – und das ohne dass dafür die gesamte Betriebsstruktur verändert werden muss.

Jörg Dietmann Co-Founder Nagarro
Es geht nicht nur um künstliche Intelligenz. Es geht um Intelligenz im Allgemeinen.“
Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig – doch ihr echter Unternehmenswert bleibt schwer greifbar. Fast jedes Unternehmen hat inzwischen in Pilotprojekte, Proofs of Concept oder Plattformen investiert. Trotzdem bleiben die Ergebnisse überschaubar: Margen, Wachstum und Anpassungsfähigkeit verändern sich kaum. Man steckt fest, gefangen in der sogenannten Pilotfalle. Die zentrale Erkenntnis? Pilotprojekte bedeuten noch keinen Fortschritt. Denn wirklicher Impact entsteht erst dann, wenn KI gezielt reale Geschäftsprobleme adressiert und Projekte mit klaren Ergebnissen und messbarem ROI verknüpft sind. Am Ende entscheidet sich das KI-Rennen nicht durch Versprechen, sondern durch Umsetzung – vom Piloten zur Produktion, vom Potenzial zur Performance.
Nagarros „Fluidic Intelligence“ Ansatz
Nagarros Konzept der „Fluidic Intelligence“ steht für einen Ansatz, der die Trennung zwischen Menschen, Daten und Entscheidungen auflöst. KI wird dort integriert, wo bisher Informationsflüsse oder Entscheidungsprozesse ins Stocken geraten sind. So können ungenutzte Potenziale freigesetzt und die Leistungsfähigkeit im Unternehmen gezielt verbessert werden.
Anwendungsbeispiele
Automotive & Fertigung
Die manuelle Rechnungserfassung führte zu Fehlern, Verzögerungen und Bruchstellen in Finanz-Workflows. Fluidic Intelligence verknüpfte menschliche Aufsicht, Unternehmensprozesse und Datenerfassung zu einem KI-gestützten System mit SAP-S/4HANA-Integration. Ergebnis: 70% weniger manueller Aufwand, höhere Genauigkeit und Roll-out bei über 20 Kunden.
Einzelhandel & Konsumgüter
Die Planung von Promotions war fragmentiert: zahlreiche Tabellen und Insellösungen erschwerten die Abstimmung zwischen menschlichem Urteil, Unternehmensrichtlinien und Datenanalysen. Mit Fluidic Intelligence konnten diese Informationsflüsse zusammengeführt und ein dynamisches Planungssystem implementiert werden. Ergebnis: 20% geringere Kampagnenkosten und schnellere Marktdurchdringung.
Software & Plattformen
Die manuelle Erstellung von Testfällen band Qualitätssicherungsteams an Skripte, fragmentierte Abläufe und ungenutzte Prozessdaten. Fluidic Intelligence half, diese Engpässe zu beseitigen – durch automatisierte Testgenerierung, selbstlernende Workflows und die Kombination von Mensch und KI. Ergebnis: 30% schnellere Testerstellung, größere Abdeckung und effizientere Abläufe ohne zusätzlichen Personalaufwand.
Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine “Fluidic Intelligence”-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.500 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter www.nagarro.com
LEADERSHIP
Dr. Sylke Piéch leitet die Akademie für Leadership, KI und Digitaltransfer und forscht am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Sie erklärt, wie KI Recruiting, Weiterbildung und Arbeit prägt.
Text: Thomas Soltau
Foto: Presse, Mina Rad/unsplash
Frau Dr. Piéch, welche Veränderungen bringt der Einsatz von KI im Recruiting?
KI-Systeme steigern Effizienz: Bewerbungen werden in Sekunden geprüft. Jobtitel und Beschreibungen lassen sich optimieren, sodass sie Talente ansprechen, die fachlich und kulturell passen. Es ist eine ethische Frage, wie stark KI im Recruiting eingesetzt wird. Standardisierte Aufgaben lassen sich entlastend automatisieren, die finale Auswahl sollte jedoch bei Menschen bleiben.
Wie stellen Unternehmen sicher, dass KI fair arbeitet?
Regelmäßige Bias-Tests und Anpassungen sind erforderlich. Unternehmen sollten Muster prüfen, Benachteiligungen erkennen und ausschließen. Wichtig sind ethische Leitlinien, repräsentative Daten, Überprüfung der Algorithmen und Transparenz. Das heißt nachvollziehbare Kriterien, offene Kommunikation und prüfbare Prozesse. Dokumentierte Änderungen und vielfältige Datensätze senken Fehlerrisiken. Menschliche Kontrolle ist unverzichtbar.

Dr. Sylke Piéch,
Senior Research Manager am Educational Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz DFKI
Jobtitel und Beschreibungen lassen sich optimieren, sodass sie Talente ansprechen, die fachlich und kulturell passen.
Welche Kompetenzen zählen in einer KI-geprägten Arbeitswelt?
Neben digitalen Fähigkeiten sind Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, Problemlösung, kritisches Denken und Kreativität zentral. Dazu kommen
Datenverständnis, datenbasierte Entscheidungsfähigkeit und ein reflektierter Umgang mit KI. Lernbereitschaft, Selbstmanagement und Netzwerkkompetenz helfen, Wissen zu teilen und interdisziplinär zu arbeiten. Kollaboration ist der Schlüssel zur KI-Nutzung.
Was für Chancen eröffnet KI für Weiterbildung?
KI ermöglicht Kompetenzprofile und personalisierte Lernpfade, abgestimmt auf Fähigkeiten und Ziele. Sie unterstützt Evaluation und Erfolgsmessung. Künftig werden KI-gestützte Lernräume wichtig, in denen Lernen und Arbeiten verzahnt sind. Lernpfade passen Tempo und Inhalte an Rolle und Erfahrung an. Kompetenzprofile zeigen Lücken transparent, daraus lassen sich Upskilling und Reskilling planen. Erfolgsmessungen machen Fortschritte sichtbar und unterstützen das Management.
Welche Rolle spielt der EU AI Act im HR-Bereich?
Da KI im Personalwesen als Hochrisiko gilt, sind die Anforderungen hoch. Unternehmen müssen Nachvoll-
ziehbarkeit sichern, Dokumentationspflichten erfüllen, Risiken bewerten und kontinuierlich monitoren. Dazu gehören Nachweise zur Datenqualität, Modellbeschreibungen und Protokolle. Monitoring prüft Wirksamkeit, Fairness und Datenschutz über den Lebenszyklus einer Anwendung.
KI ermöglicht Kompetenzprofile und personalisierte Lernpfade, abgestimmt auf Fähigkeiten und Ziele. Sie unterstützt Evaluation und Erfolgsmessung.
Weiterbildungstipp
Masterkurs „KI & Leadership“ –moderne Führung im KI-Zeitalter, praxisnah zu Leadership, Datenkompetenz und ethischer KI. Weitere Infos: ki-leadership.org

Die 3 Strategien, die jede Führungskraft benötigt, um das Potenzial von Mensch und KI zu entfalten
Künstliche Intelligenz definiert die Arbeitswelt von Grund auf neu. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen Personal, Prozesse und Technologie neu aufstellen.
Laut World Economic Forum werden bis 2030 rund 22 Prozent der heutigen Jobs neu entstehen oder wegfallen; zugleich verlieren rund 40 Prozent der heute geforderten Fähigkeiten an Relevanz. 63 Prozent der Arbeitgeber nennen fehlende Skills als größte Hürde ihrer Transformation. Statische Jobrollen weichen dynamischen Skills, die von der KI in Echtzeit erkannt, abgebildet und verwaltet werden müssen. Unternehmen stehen damit unter Zugzwang: Sie müssen HR als Kernaufgabe verstehen, genauso wie Change Management und Training der Mitarbeitenden im Umgang mit KI. Künstliche Intelligenz gilt als Hebel, weil sie Routineaufgaben automatisieren, Lernprozesse personalisieren und Skills transparent machen kann. Doch ohne Akzeptanz und Befähigung der Mitarbeitenden bleibt das Potenzial der KI ungenutzt. Wie das gelingt, erläutern Thorsten Rusch und Dr. Sebastian Duda von Cornerstone.
HR gestaltet den Wandel vom rein Operativen hin zur Wirkungsebene und setzt Leitplanken für den sicheren Einsatz von KI.
Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, HR mit Künstlicher Intelligenz neu auszurichten? Fachkräftemangel, demografischer Wandel und steigender Produktivitätsdruck treffen zugleich aufeinander. Unternehmen müssen mit denselben Ressourcen mehr Wirkung erzielen. Wer KI jetzt konsequent verankert, verwandelt Druck in Produktivität – wer zögert, verliert Tempo und Talente. Die Technologie ist längst vorhanden, 2025 wird zum Jahr der Umsetzung. Wer abwartet, riskiert Schatten-IT, wenn Mitarbeitende auf private Tools ausweichen.
Welche Rolle hat HR in dieser Transformation? HR wird zum Architekten der Produktivität. Es treibt das notwendige Change Management in den Köpfen der Mitarbeitenden, schafft Transparenz über Skills und befähigt Mitarbeitende mit relevanten Skills, um die Transformation zu meistern. An die Stelle von starren
Unternehmen auf der ganzen Welt stehen vor zwei dringenden Herausforderungen:

KI so einzusetzen, dass sie tatsächlich die Produktivität steigert.
Die Mitarbeiter darauf vorzubereiten, sicher mit KI zu arbeiten.

Doch 50 % der Führungskräfte weltweit nennen mangelnde Skills als größtes Hindernis für die Einführung von KI.*
Zuweisungen treten personalisierte Lernangebote. HR gestaltet den Wandel vom rein Operativen hin zur Wirkungsebene und setzt Leitplanken für den sicheren Einsatz von KI.
Wie erkennen Unternehmen Skill-Gaps und planen ihre Workforce?
Entwicklung der AI-Fluency ihrer Mitarbeiter:innen
Die KI-gestützte Skills Intelligence macht Skills sichtbar und zeigt Lücken im Vergleich zum Markt. Cornerstone verarbeitet dafür täglich riesige Mengen an Profil- und Arbeitsmarktdaten aus mehr als 180 Ländern und erstellt dynamische Skill-Landkarten. So können HR-Teams proaktiv entscheiden: Upskilling, interne Mobilität oder Recruiting –bevor Projekte ins Stocken geraten.

Einsatz von KI, um zwischenmenschliche Fähigkeiten aufzubauen

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen Unternehmen eine neue Art von Belegschaft aufbauen – eine, die sowohl KI-gestützt als auch menschenzentriert ist. Wie sieht das in der Praxis aus?
Arbeit so gestalten, dass beide erfolgreich sein können
Bei Cornerstone nennen wir dies die Workforce-Transformation von Menschen + KI. Menschen tun, was sie am besten können. Den Rest erledigt die KI.
Warum ist AI Fluency entscheidend?
Die größte Hürde ist nicht die Technik, sondern das Wissen im Umgang damit. 57 Prozent der Beschäftigten haben bislang kein formales KI-Training erhalten, 40 Prozent wünschen sich aktive Unterstützung durch Führungskräfte. AI-Fluency-Programme bündeln Aspekte wie Ethik, Datenschutz, Prompting und rollenspezifische Praxis, damit Teams sicher und produktiv arbeiten können.
entwickeln Lernpfade, abgestimmt auf Rolle, Projekt oder Skill-Gap. Content Agents kuratieren vorhandene Inhalte und machen sie interaktiver. Dank Integration von Cornerstone Lösungen in Microsoft Teams, Outlook, PowerPoint, Salesforce und den Browser greifen Mitarbeitende direkt im Arbeitsfluss darauf zu. Das Ergebnis: weniger Nacharbeit, schnelleres Onboarding, relevantere Weiterbildung. Ein Beispiel aus der Praxis: Im Vertrieb entsteht der Lernpfad automatisch – die Zeit bis zur ersten qualifizierten Produktdemo verkürzt sich so deutlich.
Wie sieht eine erfolgreiche HR-Strategie in Zukunft aus?
klare Kennzahlen – etwa Automatisierungsquoten, Time-to-Competency oder interne Besetzungen. Kontinuierlicher Change und AI Fluency verankern dies im Alltag. Cornerstone unterstützt Unternehmen dabei, diese Transformation pragmatisch zu gestalten – mit skalierbaren AI Agents, integrierter Skills Intelligence und Programmen zur schnellen Befähigung der Mitarbeitenden. So wird aus technologischem Potenzial konkrete Produktivität im HR-Alltag.
Wie unterstützen die Cornerstone Galaxy AI Agents konkret?
Admin Agents übernehmen Zuweisungen, Compliance-Monitoring, Übersetzungen und Reporting. Learning Agents
KI Mensch: Nutzung von KI zum Aufbau zwischenmenschlicher Fähigkeiten
Die Zukunft heißt Human plus AI. Künstliche Intelligenz übernimmt Routinen, Menschen bringen Kontext, Empathie und Entscheidungen ein. Erfolgreiches HR orchestriert eine integrierte Plattform statt isolierter Tools, definiert Governance und steuert Wirkung über
Selbst in einer KI-orientierten Welt sind zwischenmenschliche Fähigkeiten dreimal stärker gefragt als technische Skills. Dennoch fällt es
AI-Fluency-Programme bündeln Aspekte wie Ethik, Datenschutz, Prompting und rollenspezifische Praxis, damit Teams sicher und produktiv arbeiten können.
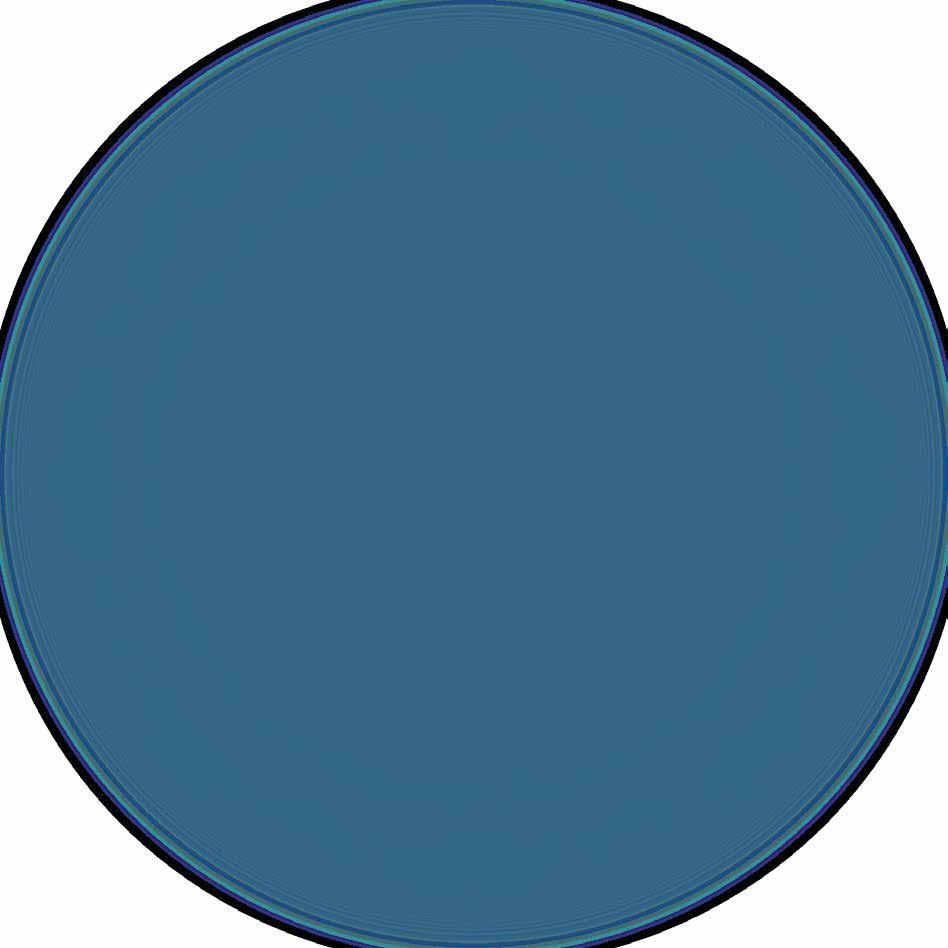
Prof. Dr. Yasmin Weiß ist Professorin mit Forschungsgebiet „Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt“ an der Technischen Hochschule Nürnberg. Die Expertin für die Arbeitsteilung zwischen Menschen und Maschine betont die Potenziale, aber auch die Limitationen beim Einsatz von KI in der Personalarbeit.
Text: Katja Deutsch
Foto: Presse, Etienne Boulanger/Unsplash
Frau Prof. Dr. Weiß, kann KI schon heute Unternehmen dabei helfen, den Fachkräftemangel zu bekämpfen?
Unternehmen setzen natürlich auf KI, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, was mit wachsender Leistungsfähigkeit von Technologie zunehmend möglich ist. Allerdings sehen wir gerade auch einen Trend, der zu Lasten der jungen Generation geht: nämlich, dass gerade Tätigkeiten auf Einstiegspositionen mit KI automatisiert und damit Stellen für junge Absolventen eingespart werden. Aufgaben beispielsweise, die man früher als junger Berufseinsteiger im Consulting übernommen
In der Personalauswahl ist KI in Europa durch strenge Datenschutzregelungen stark begrenzt.
hat, wie Recherche, Datenanalyse, Terminplanung oder die Erstellung, Übersetzen und graphisches Optimieren von Präsentationen, lassen sich heute mit KI-Tools oder agentischen KI-Systemen erledigen. Das spart zwar Arbeitskräfte ein, entzieht aber zugleich der Nachwuchsförderung die Basis. Gefragt ist daher nicht nur das Ersetzen, sondern auch das Neudenken von Einstiegsjobs: Mit KI-basierter Skill-Augmentation und schnellen Einarbeitungsmöglichkeiten in komplexe Themengebiete können Berufseinsteiger von Anfang an auch diffizile Aufgaben übernehmen und so trotz geringer Berufserfahrung schon wichtige Wertbeiträge im Unternehmen leisten. Gleichzeitig eröffnen sich durch die Verbindung von KI und smarter Hardware neue Lösungen für vom Fachkräftemangel betroffene Branchen: Humanoide und Industrieroboter entlasten bspw. die Produktion, Heberoboter unterstützen in der Pflege.

Prof. Dr. Yasmin Weiß, Professorin mit Forschungsgebiet „Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt“ an der Technischen Hochschule Nürnberg
Wir Menschen bleiben die Kapitäne: Wir setzen Ziele, tragen Verantwortung und geben Leitplanken vor, KI agiert als Copilot.
Inwiefern verändert KI den Einsatz im HR-Bereich schon jetzt? KI entlastet die Personalarbeit vor allem bei administrativen Aufgaben, etwa durch HR-Chatbots, die Standardfragen wie etwa zu Elternzeit, Sabbaticals oder Jobrad-Anträgen beantworten. So gewinnen Personalabteilungen mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten wie individuelle Beratung und wertschätzende Gespräche, bei denen der Mensch unverzichtbar ist. In der Personalauswahl
ist KI in Europa durch strenge Datenschutzregelungen stark begrenzt: Sie unterstützt bislang höchstens in der Vorauswahl, die Endauswahl und finale Entscheidung treffen weiterhin Menschen.
Welche Verantwortung tragen HRManager, wenn KI Entscheidungen über Bewerbungen und über Beförderungen unterstützt?
KI in der Personalauswahl soll nicht autonom entscheiden, sondern Menschen unterstützen. Beide Seiten bringen Bias mit: Menschen durch subjektive Voreingenommenheiten auf Basis der eigenen Biographie, KI durch voreingenommene Trainingsdaten. Ziel ist ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine, das Entscheidungen auf eine objektivere, datengetriebene Basis stellt und ergänzt wird durch menschliche Sozialkompetenz und Sichtweisen. Voraussetzung sind möglichst Bias-freie Daten und geschulte HR-Mitarbeitende, die sich ihrer eigenen Vorurteile bewusst sind.
Könnte KI irgendwann völlig autonome Entscheidungen treffen?
Die Rollenverteilung zwischen humaner und künstlicher Intelligenz ist wichtig: Wir Menschen bleiben die Kapitäne: Wir setzen Ziele, tragen Verantwortung und geben Leitplanken vor, KI agiert als Co-Pilot.

workday – Partner Content

KI-Agenten halten Einzug in deutsche Unternehmen – ihre Rolle und ihr Einsatz im Arbeitsalltag eröffnen Chancen, werfen aber auch Fragen auf.
KI-Agenten, die Mitarbeitende entlasten oder Prozesse automatisieren, sind längst mehr als nur ein vorübergehender Trend. Ihr Einsatz häuft sich zunehmend und schon heute zeigen sich konkrete Erfolge: Unternehmen berichten von schnellen Entscheidungsprozessen und neuen Möglichkeiten für strategische Arbeit. Beschäftigte schätzen besonders, dass KI-Agenten ihnen repetitive Tätigkeiten abnehmen und so Raum für kreativere und anspruchsvollere Aufgaben schaffen. Gleichzeitig rücken ethische und sicherheitsrelevante Fragen in den Fokus, insbesondere in Bereichen, in denen sensible Daten vor unzulässigem Gebrauch geschützt werden müssen. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, den Spagat zwischen Effizienzsteigerung und Zufriedenheit innerhalb der Belegschaft zu meistern. Zugleich gilt es, den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz nachhaltig und im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben zu gestalten.
Studiendaten belegen Hoffnung deutscher Beschäftigter Die aktuelle Studie „AI Agents Are Here – But Don’t Call Them Boss“ von Workday zeigt eine eindeutige Richtung: 81 Prozent der deutschen Beschäftigten fühlen sich wohl dabei, mit KI-Agenten zusammenzuarbeiten – doch nur ein Drittel kann es sich vorstellen, von einer
Beschäftigte schätzen besonders, dass KI-Agenten ihnen repetitive Tätigkeiten abnehmen und so Raum für kreativere und anspruchsvollere Aufgaben schaffen.
KI geführt zu werden. Während eine große Mehrheit die Unterstützung dankbar annimmt, werden klare Grenzen gefordert, wenn es um Kontrolle und Entscheidungshoheit geht. Mit wachsender Nutzungserfahrung nimmt auch die Akzeptanz von KI-Agenten zu: Vertrauen lediglich 36 Prozent der weniger erfahrenen Beschäftigten ihrem Unternehmen einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu, sind es bei erfahrenen Nutzenden bereits 95 Prozent.
Deutlicher Mehrwert etwa im Finanzbereich erwartet 76 Prozent der deutschen Befragten erwarten, dass KI-Agenten helfen, den Fachkräftemangel im Finanzbereich auszugleichen. Den größten Vorteil sehen die Beschäftigten in der Finanzberichterstattung (31 Prozent), der Betrugserkennung (27 Prozent) und der Datenkonsolidierung (23 Prozent). Die Mehrheit der Unternehmen befindet sich dabei nicht mehr in Pilotprojekten, sondern plant in den kommenden drei Jahren eine deutliche Skalierung der Systeme. Die Vorteile liegen für die
Für mehr Informationen zur Workday-Studie ”AI Agents Are Here – But Don’t Call Them Boss” scannen Sie den QR-Code.
Befragten auf der Hand: 90 Prozent erwarten, dass durch KI-Agenten die Produktivität steigt, während sich 83 Prozent schnellere Innovationszyklen erhoffen. Auch die Auswirkungen auf die Mitarbeitendenentwicklung und Arbeitszufriedenheit werden überwiegend positiv eingeschätzt. Zugleich gibt es Bedenken, dass die Produktivitätsgewinne auch zu höherem Leistungsdruck, weniger kritischem Denken und einer Abnahme zwischenmenschlicher Interaktionen führen könnten.
Als größte Hürde für eine flächendeckende Integration nennen Führungskräfte und Mitarbeitende Sicherheits- und Datenschutzthemen (36 Prozent), gefolgt von ethischen Bedenken (29 Prozent). Viele Unternehmen verfügen über grundlegende Sicherheits- und Ethikrichtlinien, doch fortgeschrittene Mechanismen zur Überwachung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind selten etabliert. Für den nachhaltigen Einsatz von KI im Arbeitsalltag werden daher neben leistungsfähigen Technologien auch klare Regeln und eine menschliche Aufsicht gefordert.
Der Mensch im Fokus „In unseren Gesprächen mit Unternehmen sehen wir immer wieder, wie unterschiedlich die Anforderungen sind“, erklärt Jens Löhmar, CTO Kontinentaleuropa und DACH bei Workday. „Deshalb setzen wir bei KI & KI-Agenten auf einen flexiblen Ansatz: Manche Organisationen brauchen sofort einsetzbare Standardlösungen, andere benötigen individuelle Anpassungen. Entscheidend ist in beiden Fällen, dass der Mensch im
Fokus steht und nachvollziehbar ist, was die KI macht.” Die Studienergebnisse machen deutlich: Die erfolgreiche Integration von KI-Agenten erfordert mehr als die technische Umsetzung. Es geht darum, Vertrauen in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine aufzubauen. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden transparent auf dem Weg mitnehmen, sind besser aufgestellt, um die Chancen der neuen Arbeitswelt langfristig zu nutzen.

Jens Löhmar, CTO Kontinentaleuropa & DACH bei Workday
Manche Organisationen brauchen sofort einsetzbare
Standardlösungen, andere benötigen individuelle Anpassungen. Entscheidend ist in beiden Fällen, dass der Mensch im Fokus steht und nachvollziehbar ist, was die KI macht.
Die KI-Plattform Workday unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Personal, Finanzen und Agenten. Workday wird von mehr als 11.000 Organisationen weltweit und branchenübergreifend eingesetzt – von mittelständischen Unternehmen bis hin zu mehr als 60 Prozent der Fortune 500. Weitere Informationen unter: workday.com

WEITERBILDUNG
Künstliche Intelligenz dringt in sämtliche Berufsfelder vor. Angst davor zu haben, hilft nicht weiter. Schulungen dagegen schon.
Text: Katja Deutsch
Foto: Mikhail Nilov/pexels
„Meine Assistentin Merle schicke ich jetzt in den Urlaub – und danach erhält sie eine Umschulung. Ihren Job übernimmt künftig KI.“ Solche Beiträge liest man derzeit häufig auf LinkedIn. Denn viele Aufgaben, die früher Merle erledigt hat, übernehmen inzwischen KI-Tools in einem Bruchteil der Zeit. Merle hat Glück: Ihr Chef ersetzt sie nicht durch Technologie, sondern bildet sie im Umgang mit KI weiter.
Die neuen KI-Anwendungen wecken Begeisterung und Sorge zugleich. Mitarbeitende befürchten, dass KI ihre Arbeit überflüssig macht, während Führungskräfte sich davor fürchten, zu zögerlich zu reagieren, falsche Entscheidungen zu treffen und damit das Unternehmen zu gefährden. Diese Ängste sind berechtigt und sollten nicht ignoriert werden. KI wird zweifellos bestimmte Aufgaben automatisieren, schafft jedoch zugleich neue Rollen: für diejenigen, die KI-Ergebnisse inter-
pretieren, steuern und hinterfragen. Die eigentliche Gefahr liegt daher nicht in der Technologie selbst, sondern im Nichtstun. Wer stehen bleibt, riskiert den Anschluss zu verlieren. Unternehmen, die sich nicht mit den Chancen und Risiken von KI auseinandersetzen, laufen Gefahr, in wenigen Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.
Die Europäische Union hat die Bedeutung von KI-Kompetenzen erkannt und 2024 die EU-KI-Verordnung (AI Act, Regulation (EU) 2024/1689) verabschiedet. Ein zentraler Bestandteil ist Artikel 4 zur „KI-Kompetenz“ (AI Literacy), der Unternehmen verpflichtet, ihre Mitarbeitenden mit ausreichendem Wissen im Umgang mit KI auszustatten. Für die Jahre 2025 bis 2027 stellt die EU dafür 1,3 Milliarden Euro für Künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste, Cybersicherheit und digitale Weiterbildung bereit. Unternehmen sollten diese Mittel nutzen, um ihre Teams gezielt zu schulen.

Unternehmen, die sich nicht mit den Chancen und Risiken von KI auseinandersetzen, laufen Gefahr, in wenigen Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.
Doch es reicht nicht aus, lediglich ein paar neue KI-Tools einzuführen. Was heute als innovativ gilt, kann schon in wenigen Monaten veraltet sein. Deshalb ist es entscheidend, nicht nur auf einzelne Anwendungen zu setzen, sondern ein „KI-Mindset“ im Unternehmen zu etablieren. Dieses Mindset bedeutet, zu verstehen, was KI leisten kann und was (noch) nicht, und die Technologie nicht als unfehlbare Autorität zu betrachten, sondern ihre Ergebnisse kritisch zu prüfen und verantwortungsvoll einzusetzen. Führungskräfte sollten die Sorgen in ihren Teams ernst nehmen und in Neugier und Experimentierfreude
LEEON – Partner Content
umwandeln. Mitarbeitende gewinnen so neue Verantwortung, nutzen KI als Co-Pilot und bleiben handlungsfähig, während Führungskräfte künftig nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen führen und deren Ergebnisse kontrollieren müssen.
Merle, die Assistentin der Geschäftsführung, ist ein gutes Beispiel dafür. Damit sie ihren Job auch in Zukunft behalten und erfolgreich ausüben kann, wird sie kontinuierlich lernen müssen. KI wird Menschen nicht ersetzen, doch Menschen, die mit KI arbeiten, werden diejenigen verdrängen, die es nicht tun.
für das zukünftige Berufsleben unverzichtbar
Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern prägt bereits heute zahlreiche Geschäftsbereiche. Vor allem im Kundenkontakt, im Marketing und in der Kommunikation werden vielfach KI-Tools eingesetzt. Laut aktueller Bitkom-Studie vom September 2025 steckt die Künstliche Intelligenz jedoch in vielen anderen Unternehmensbereichen noch in den Kinderschuhen. Ein zentraler Grund für diesen zögerlichen Umgang ist fehlendes Wissen über die Potenziale, Unsicherheiten sowie Sorgen über die Sicherheit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit im Umgang mit KI-Anwendungen. Genau hier setzen gezielte Schulungen an: Sie befähigen Mitarbeitende, KI-Tools nicht nur zu nutzen, sondern sie sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren und neue Anwendungsfelder zu erschließen.
Justus Leendertz, Geschäftsführer der A-Leecon GmbH, schult Angestellte wie Arbeitssuchende im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Dabei geht es nicht nur um Fachwissen, sondern um Hilfe zur Selbsthilfe: Wir alle müssen lernen, uns ständig in neue Tools und Strukturen selbst einzuarbeiten.
Justus, welche KI-Kenntnisse vermittelt die LEEON Advanced Learning?
Bei LEEON vermitteln wir nicht nur technisches KI-Know-how, sondern befähigen Menschen, KI sicher, kreativ und wirksam in ihren Arbeitsalltag zu
integrieren. Entscheidend ist dabei das Mindset: Wir sehen KI nicht als reines Tool, sondern als Gamechanger. Wir bilden die Mitarbeitenden darin aus, die erforderliche Offenheit, Neugier und Lernbereitschaft zu entwickeln, um ihr Potenzial voll zu entfalten. Unser Angebot reicht von strategischem KI-Management für Führungskräfte über praxisnahe Anwendungen für den Arbeitsalltag bis zu Marketing mit KI. Wir zeigen zudem, wie sich agile Arbeitsorganisation, Projektmanagement und sogar die Entscheidungsfindung durch KI unterstützen lassen. Selbst Programmieren geht damit plötzlich
ganz einfach. Selbstverständlich ist der Einsatz von KI jedoch kein rechtsleerer Raum: Wer KI einsetzt, muss Verantwortung übernehmen – von Datenschutz bis Urheberrecht. Dies gehört bei uns zwingend zum Lernprozess.
Warum bietet ihr eine Lernbegleitung an?
Unser E-Learning und der KI-Coach Leeon vermitteln rund um die Uhr verständlich und anschaulich Wissen. Ergänzend schätzen unsere Teilnehmenden den direkten Austausch mit unseren Expert:innen als Lernbegleitung: Sie bringen persönliche Betreuung ein und sind zudem Vorbilder und Wegbereiter.
Was kostet eine KI-Weiterbildung für Unternehmen bzw. Arbeitssuchende? Als zertifizierter Bildungsanbieter sind unsere Weiterbildungen bis zu 100 Prozent förderfähig, und zwar sowohl für Arbeitssuchende als auch für Beschäftigte. Die Möglichkeiten der Beschäftigtenqualifizierung ist in vielen Unternehmen nicht bekannt: Über dieses Programm können sie umfang-
LEEON Advanced Learning treibt den Wandel voran: Künstliche Intelligenz (KI) verändert nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch die Art, wie wir lernen. Mit dem von LEEON Advanced Learning eigens entwickelten KI-gestützten Lernsystem und dem adaptiven Lernbegleiter Leeon wird berufliche Weiterbildung hochgradig personalisiert und effizient gestaltet. www.leeon.com
reiche Förderungen für Seminargebühren sowie Lohnkosten erhalten.
Welche Berufsperspektiven ergeben sich durch eine erfolgreiche KI-Weiterbildung bei LEEON? Wir bieten praxisnahe KI-Weiterbildungen, die Teilnehmende fit für das KI-Zeitalter machen. Davon profitieren nicht nur die Beschäftigten durch bessere Berufsperspektiven, sondern auch die Arbeitgebenden: Die erlernten KI-Kenntnisse lassen sich sofort im Arbeitsalltag umsetzen und steigern somit direkt die Produktivität. Zudem eröffnen Jobs mit KI-Kompetenzen attraktive Verdienstmöglichkeiten und liegen im Schnitt 28 Prozent über vergleichbaren Positionen.

Justus Leendertz, Geschäftsführer der A-Leecon GmbH


GPS, Online-Banking, Wetterbericht, Kundenservice, Shopping, Chat GPT – Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt uns Tag für Tag, und wird dabei immer besser. Auch, wenn man die Roboter dahinter nicht sieht.
Text: Katja Deutsch
Foto: D Koi/unsplash
1956 war ein sehr besonderes Jahr. Es war der Beginn eines Traums: Maschinen, die denken, lernen und helfen können. Auf der legendären Dartmouth Conference prägte John McCarthy erstmals den Begriff „Artificial Intelligence“ und eröffnete so das Tor zu einer Zukunft, die zuvor nur in der Fantasie existierte. Gleichzeitig eroberte Robby the Robot in Forbidden Planet die Herzen der Zuschauer: sprechend, hilfsbereit, mit fast menschlicher Persönlichkeit. Der schwarzglänzende Roboter mit kugeligen Beinen wurde zum Symbol für den Traum vom hilfreichen, freundlichen Begleiter. In diesem Jahr legten Wissenschaft und Film die Grundlagen für die heutige Künstliche Intelligenz.
In den 1950er- und 1960er-Jahren, als erstmals Fernseher in vielen Wohnzimmern flimmerten, begannen Forscher Computern das Denken beizubringen. Erste Programme konnten einfache menschliche Entscheidungen und
Problemlösungen simulieren. Einen bedeutenden Fortschritt erzielte 1970 die Forschungsorganisation des USVerteidigungsministeriums, die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Mit Straßenkartierungsprojekten und frühen Experimenten an intelligenten Systemen legte sie den Grundstein für die heutigen Navigationssysteme. DARPA ist bekannt dafür, bahnbrechende Technologien voranzutreiben, die später den Alltag prägen – so entstand unter ihrer Federführung auch das ARPANET, der Vorläufer des Internets.
Darüber hinaus spielte DARPA eine zentrale Rolle in der frühen KIForschung in den USA. Die Agentur unterstützte die Entwicklung persönlicher Assistenten und lernfähiger Software, die Aufgaben wie Terminplanung, Informationssuche oder einfache Entscheidungsfindung übernehmen konnten. Diese frühen Systeme waren die Vorläufer

Fortschritte bei der Rechenleistung sowie die Verfügbarkeit großer Datenmengen und neue Algorithmen haben in den letzten Jahren zu bahnbrechenden Durchbrüchen in der KI geführt.
von Technologien wie Siri oder Alexa. Erst Anfang der 1990er-Jahre begann der weltweite Siegeszug des Internets, 1995 drängten Amazon und eBay auf den Markt – und damit sichere Internetzahlungssysteme, basierend auf KI. Als sich Schachweltmeister Garry Kasparow 1997 geschockt von einem IBMComputer namens Deep Blue geschlagen geben musste, wurden vielen Menschen erstmals klar, dass Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist. Das neue Jahrtausend brachte für KI schließlich den Durchbruch auf breiter Ebene: Neuronale Netze, Spracherkennung, Übersetzung, Bilderkennung, Sprachassistenten – riesige Datenmengen und
bessere Algorithmen machen KI immer leistungsfähiger. Es folgte Machine Learning (ML), bei dem Computer aus Daten lernen – wie etwa Spam-Filter, die unsere E-Mails sortieren.
Daraus entstand Deep Learning (DL), eine komplexere Form, die selbstständig Muster in riesigen Datenmengen erkennt und daraus immer klügere Entscheidungen trifft. Seit etwa zehn Jahren ist KI aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Meist bemerken wir sie dabei gar nicht mehr. Denn wie Robby the Robot sieht sie nicht aus – auch, wenn sie ständig freundlich mit uns spricht und uns dabei hilft, Entscheidungen zu treffen.
ADVERTORIAL
Herr Würtz, Fsas Technologies Private GPT ermöglicht es generative KI sicher in Unternehmen zu nutzen. Was unterscheidet es von Diensten wie ChatGPT?
Der zentrale Unterschied zu Diensten wie ChatGPT ist das Prinzip der Souveränen KI. Es umfasst technologische, operative, Datenund normative Souveränität – also die Fähigkeit, eigene ethische und rechtliche Regeln für KI durchzusetzen. Für Unternehmen ist besonders die Datenhoheit entscheidend: Während bei öffentlichen Diensten Dritte Daten extern verarbeiten, erfolgt bei Private GPT die gesamte Verarbeitung in der IT-Infrastruktur des Kunden. So verlassen sensible Informationen nie das Unternehmen – ein entscheidender Faktor im datensensiblen europäischen Markt.
Sprechen wir vom „Agentic Age of AI“. Was verbirgt sich dahinter?
Das „Agentic Age of AI“ beschreibt die Entwicklung von Sprachmodellen zu einer Architektur, in der spezialisierte KI-Agenten intelligent zusammenarbeiten, um komplexe Aufgaben autonom zu lösen. Im Kundenservice können Agenten etwa eine Reklamation in Minuten bearbeiten: Ein Dialog-Agent erfasst das Problem, ein Diagnose-Agent prüft Garantie und Fehlerursache, ein Logistik-Agent organisiert Abholung und Ersatzteil, während ein Kommunikations-Agent den Kunden informiert. Diese Arbeitsteilung auf
Basis spezifischen Domänenwissens erhöht die Präzision und minimiert „Halluzinationen“.
Wie profitieren Unternehmen konkret? Sie profitieren vor allem durch deutliche Effizienzsteigerung. KI-Agenten entlasten Mitarbeiter von repetitiven Analysen, indem sie z. B. IoT-Daten auswerten oder Informationen bei der RPA-Integration validieren. So können sich Angestellte auf höherwertige Aufgaben konzentrieren. Zudem sind Kosten planbar, da nicht pro Abfrage abgerechnet wird. Und im Fehlerfall können Agenten den Regelbetrieb schneller wiederherstellen als ein Mensch.
Wie gewährleisten Sie die Sicherheit? Sicherheit hat oberste Priorität. Wir gewährleisten sie durch robuste Frameworks, starke End-to-End-Verschlüsselung und, wichtig, granulare Datenzugriffsrechte bis auf Benutzerebene. Dieser präzise Zugriff macht das Training von Modellen mit Unternehmensdaten überflüssig und erhöht zugleich die Energieeffizienz. Da die Verarbeitung ausschließlich lokal auf angepassten Modellen erfolgt, sichern wir nicht nur die Compliance, sondern stärken auch das Vertrauen in die KI-Ergebnisse.
Welchen strategischen Vorteil sehen Sie für europäische Unternehmen?
Private GPT ist ein strategischer Schritt, der Unternehmen ermöglicht, generative KI zu
nutzen, ohne Datenhoheit aufzugeben. Es ist der Schlüssel, um digitale Transformation und Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben und dabei höchste Datenschutz- und Compliance-Standards zu erfüllen. Unternehmen können das „Agentic Age of AI“ sicher und datenschutzkonform in der eigenen Infrastruktur gestalten.

Udo Würtz ist CTO bei Fsas Technologies – a Fujitsu company und Experte im Bereich Künstliche Intelligenz und teilt sein Wissen in seinem YouTube-Kanal zum Thema KI.
Weitere Informationen unter: www.fsastech.com/de-de
EFFIZIENZ
Wie Künstliche Intelligenz Energie spart, Ausschuss senkt und Kosten reduziert – ohne Greenwashing. Das weiß Experte Dr. Joachim Lentes, Fachreferent Digital Manufacturing am Fraunhofer IAO.
Text: Thomas Soltau
Foto: Presse, Cottonbro Studio/pexels

Dr. Joachim Lentes, Fachreferent Digital Manufacturing am Fraunhofer IAO
Herr Dr. Lentes, KI-Einsatz in der Industrie gilt als Hebel für Nachhaltigkeit. Welche konkreten Einsparungen haben Sie zuletzt gemessen? Wir messen in Projekten signifikante Effekte: Durch KI-basierte, vorausschauende Instandhaltung in einem produzierenden Unternehmen, konnten wir die durchschnittliche Zeit, bis Fehler an einer Maschine auftreten, um 24 Prozent verlängern, die Reparaturzeit um 46 Prozent verkürzen, den Ausschuss um 14 Prozent reduzieren und die Instandhaltungskosten um 23 Prozent senken. Unsere Fraunhofer-Studie zeigt darüber deutliche Potenziale in Bezug auf Energie, Ausschuss und Stillstände –abhängig von Prozess und Datenreife.
Ihr Leitfaden schlägt sieben Schritte vor. Welche davon greifen Unternehmen erfahrungsgemäß zuerst auf? Unternehmen starten erfahrungsgemäß sinnvollerweise mit einem klaren Zielbild, das durch konkrete Angaben ergänzt wird. Dabei können beispielsweise ökologische Kennzahlen, Systemgrenzen und absolute Reduktionspfade definiert werden. Dazu muss die Datenbasis aufgebaut werden, beispielsweise durch die Anbindung von Energiezählern und Unternehmenssoftware wie ERP und MES, aber – wenn möglich – auch der Fertigungseinrichtungen. Dann werden schnelle Erfolge durch „Proof-of-Value-Use Cases“ geschaffen, zum Beispiel in Instandhaltung, Energieoptimierung oder Qualitätsregelung.
Effizienzgewinne bergen die Gefahr von Rebound-Effekten. Wie verhindern Firmen, dass Einsparungen am Ende verpuffen?
Rebound-Effekte können durch Governance mit absoluten Zielen, beispielsweise für THG, internem CO2Preis und Budget- bzw. Lastkappungen vermieden werden. Sinnvoll sind dabei
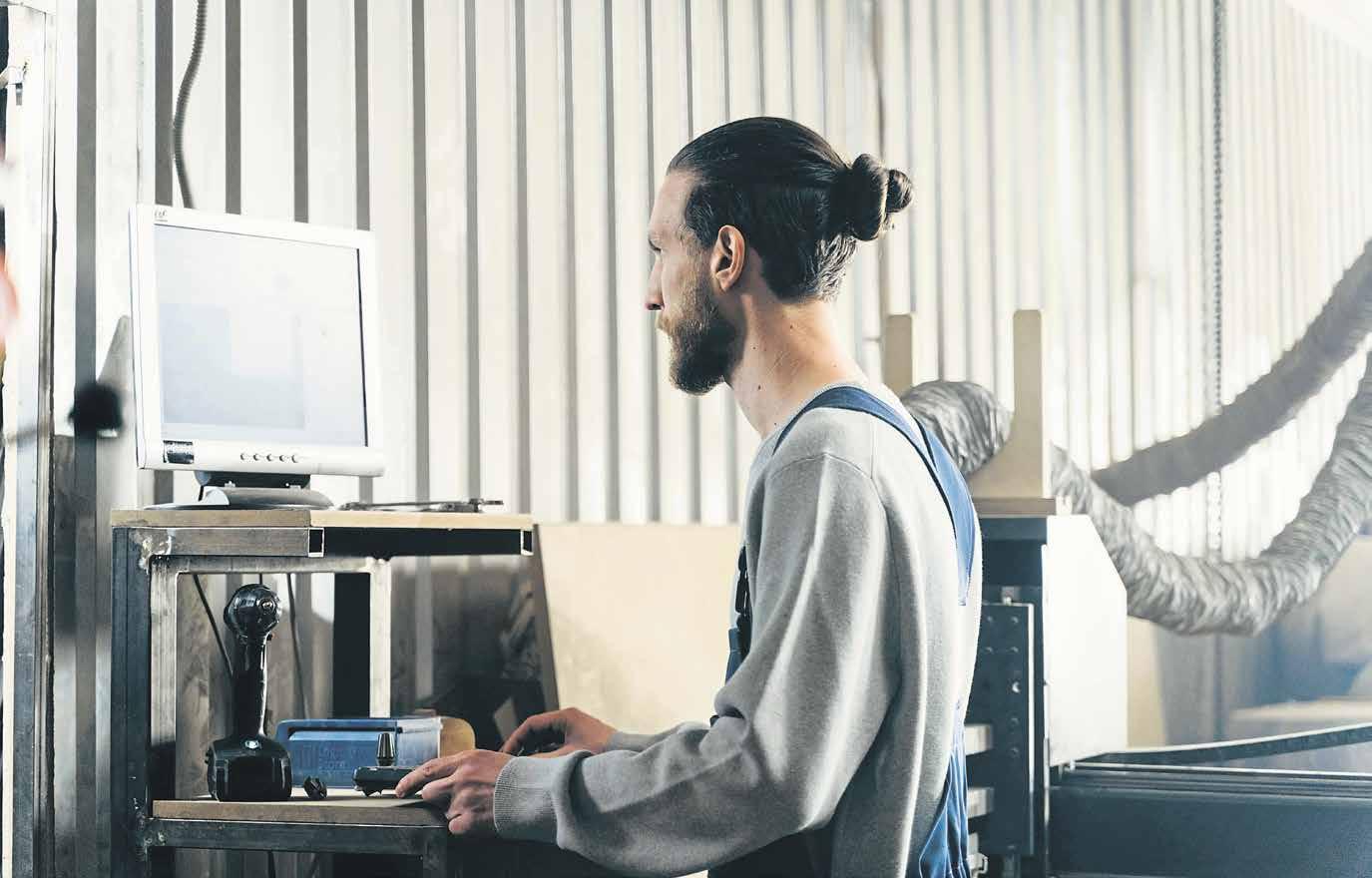
KI unterstützt KMU u. a. bei der Datenerhebung in Bezug auf Energiezähler, Materialflussdaten und Unternehmenssoftware.
KPI-Systeme mit absoluten und spezifischen Kennzahlen zur Bindung von Effizienzgewinnen an den Reduktionspfad und Vermeidung der Neutralisierung der Effekte durch Mengenausweitung.
Der ökologische Fußabdruck von KI kann durch den Einsatz von „Green AI“ verkleinert werden.
Viele Mittelständler kämpfen mit lückenhaften Daten. Ab wann lohnt sich der Einstieg in KI-gestützte CO₂-Bilanzierung?
KI unterstützt nicht nur bei der Datenerhebung in Bezug auf Energiezähler, Materialflussdaten und Unternehmenssoftware wie ERP und MES, sondern auch deren Vervollständigung per Imputation und der Anomalieerkennung, sowie der Plausibilisierung von Lieferantendaten. Daher sehen wir keine konkreten Grenzwerte, ab denen sich der Einstieg in die KI-gestützte CO2Bilanzierung lohnt, sondern empfehlen die Betrachtung des konkreten Falls und gegebenenfalls eine schrittweise, nutzenorientierte Einführung von KI.
Digitale Zwillinge werden oft als Allzwecklösung gepriesen. Wo sehen Sie tatsächlich den größten Nachhaltigkeitsnutzen?
Den größten Nachhaltigkeitsnutzen sehen wir in Produktions- bzw. Prozesszwillingen für die Energie- und Qualitätsoptimierung sowie in Digitalen Zwil-
lingen von Maschinen und Anlagen für die prädiktive Instandhaltung. Praxisnah sind zum Beispiel Lastverschiebungen sowie Qualitätsoptimierungen auf der Grundlage von Produktionsprozessdaten, die wir häufig ja sogar in der manuellen Montage, etwa mit vernetzten Industrie 4.0-Akkuschraubern, gewinnen können. Damit können Energie- und Ausschussverluste im laufenden Betrieb spürbar gesenkt werden.
Kritik am Energiehunger von KI-Modellen wächst. Welche Technologien mindern den ökologischen Fußabdruck?
Der ökologische Fußabdruck von KI kann durch den Einsatz von „Green AI“ verkleinert werden – beispielsweise durch den Einsatz kleinerer und quantisierter ML-Modelle, Distillation und Edge-Interferenz statt großskaliger Cloud-Modelle. Zweckmäßig für die Minderung des ökologischen Fußabdrucks sind auch die Versorgung von Rechenzentren mit Ökostrom und gutem PUE sowie die Durchführung der ML-Trainings bei EE-Überschuss. Grundsatz in Bezug auf die MLModelle sollte sein: „So groß wie nötig – so schlank wie möglich“.
Der digitale Produktpass wird bald Realität. Wie trägt KI dazu bei, seine Datenqualität sicherzustellen? Mit KI können Daten aus Unternehmenssoftware wie ERP und PLM, aber auch aus Office-Dateien wie PDF extrahiert werden. Die so gewonnenen Daten können durch KI verknüpft und Anomalien erkannt werden. Die Verbesserung der Qualität und Vollständigkeit der Daten unterstützt Auditierbarkeit und Skalierbarkeit des DPP.
Pilotprojekte gibt es viele. Warum hapert es aus Ihrer Sicht bei der Skalierung in den Alltag?
Typische Hürden bei der Skalierung von KI-Pilotprojekten in den Unternehmensalltag sind die Datenharmonisierung, eine mangelnde IT-OT-Integration, aber auch weiche Faktoren wie Kompetenzen bzw. benötigte Trainings und Change Management. Hilfreich sind unter anderem klare Product Owner, wiederverwendbare Daten- und ML-Pipelines sowie Blueprints, mit denen Lösungen standardisiert ausgerollt werden können.
Greenwashing-Vorwürfe stehen schnell im Raum. Welche Regeln braucht „nachhaltige KI“, um glaubwürdig zu bleiben?
Glaubwürdige „nachhaltige KI“ braucht klare Systemgrenzen und absolute Ziele, zum Beispiel für die Treibhausgasemissionen. Angaben müssen transparent sowie objektiv überprüfbar sein und überprüft werden, ggf. auch per Third-Party-Assurance, und werden idealerweise auf der Grundlage eines Energie- und CO2Monitorings je Modell zur Verfügung gestellt. Modelle sollten verworfen werden, wenn schlankere Alternativen denselben Nutzen mit geringerem ökologischem Fußabdruck liefern.
Glaubwürdige „nachhaltige KI“ braucht klare Systemgrenzen und absolute Ziele, zum Beispiel für die Treibhausgasemissionen.
Künstliche Intelligenz ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug für Wirkung. Die Wilo Group zeigt, wie sich digitale Lösungen mit intelligenten Wassertechnologien verbinden lassen – für Effizienz, Verantwortung und Lebensqualität.
Wer Wasser bewegt, bewegt Gesellschaft, Städte und Industrie. Ohne Wasser läuft nichts – auch nicht die digitale Wirtschaft. Deshalb verknüpft die Wilo Group ihre Nachhaltigkeitsstrategie eng mit KI. Unter dem Namen WATER AI bündelt das Unternehmen sein Denken und Handeln: Lösungen sollen intelligenter, effizienter und menschlicher werden. Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo Group, bringt die Haltung auf den Punkt: „Nur wenn wir die KI umarmen, uns auf sie einlassen und sie als Chance verstehen, können wir die eigentlichen Potenziale für uns nutzen.“ Das ist Anspruch und Leitplanke zugleich.
WATER AI steht für drei klare Säulen: We enable AI. We embed AI. We embrace AI. Erstens entwickelt Wilo Wassertechnologien für Industrien entlang der Wertschöpfungskette von KI, etwa Rechenzentren oder Chipfabriken – Orte, an denen jeder Grad und jede Minute zählen. Intelligente Kühlkreisläufe sichern Stabilität und sparen Energie. Zweitens integriert Wilo KI direkt in Produkte, Systeme und Lösungen: So entstehen Lösungen, die sich selbst optimieren, Daten in Echtzeit verarbeiten und sich an unterschiedliche Betriebsbedingungen anpassen. Drittens nutzt das Unternehmen KI intern – von Forschung und Entwicklung über Produktion und Logistik bis zum Service. Digitale Zwillinge beschleunigen Tests, Assistenten helfen im Alltag und vorausschauende Analysen verkürzen Reaktionszeiten.
Die Stoßrichtung ist praktisch, nicht pathetisch. Wenn Gebäude effizienter

heizen und kühlen, wenn in Städten weniger Wasser verloren geht, wenn Industrieprozesse planbarer werden, dann entsteht messbarer Nutzen. Oliver Hermes sagt dazu: „Wir können mit zahlreichen Anwendungen in der Entwicklung und Produktion unserer Produkte, Systeme und Lösungen schon heute als echter KI-Pionier gelten. Ein herausragendes Beispiel dafür ist ohne Zweifel unsere Hightech-Fabrik am Konzernhauptsitz in Dortmund, die Smart Factory.“ Das Ziel: Performance und Verantwortung verbinden.
Der strategische Rahmen bleibt dabei breit und bodenständig. Die Wilo Group denkt KI entlang ihrer drei Nachhaltigkeitswirkbereiche Creating, Caring und Connecting. Creating heißt: Wilo bietet nachhaltige Lösungen, die reale Herausforderungen lösen – etwa Energie sparen, Ausfälle vermeiden, Ressourcen schonen. Caring bedeutet: den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehört, Emissionen zu reduzieren, Daten zu schützen, Risiken zu begrenzen. Connecting steht für starke Partnerschaften – mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. So wird aus Technologie ein Ökosystem. „Wir befähigen die Wertschöpfungskette von KI, implementieren KI in unsere Produkte, Systeme und Lösungen und integrieren KI in unsere tägliche Arbeit – ohne dabei den Menschen aus den Augen zu verlieren“, fasst der Wilo-CEO zusammen.
Auch organisatorisch ist der Kurs eindeutig gesetzt. Interne Initiativen reichen von KI-gestützten Entwicklungsumgebungen über automatisierte Qualitätsberichte bis zu
Supportkanälen, die Anfragen schneller klären. Die Logistik plant vorausschauender, die Fertigung arbeitet flexibler, der Service wird persönlicher. Entscheidend ist, Komplexität zu beherrschen – nicht zu erhöhen. Deshalb legt Wilo Wert auf Transparenz und Verantwortlichkeit. KI soll Mitarbeitende stärken, nicht ersetzen, und Kundinnen und Kunden klare Entscheidungen ermöglichen.
Am Ende zählt Wirkung. Wenn KI hilft, Energie und Wasser smarter zu nutzen, gewinnt die Gesellschaft doppelt: Kosten sinken, Emissionen auch. Genau das macht WATER AI zu mehr als einem Schlagwort – zu einem Versprechen, das sich im Alltag messen lässt. Ein solches Vorgehen bleibt nicht theoretisch. Wilo wurde als praxisnaher KI-Vorreiter in der Produktentwicklung ausgezeichnet; die Mitgliedschaft im KI Park e. V. bekräftigt die Partnerschaft mit Wirtschaft und Forschung. Rund 10.000 Mitarbeitende verbinden seit mehr als 150 Jahren Wassertechnologie und Digitalisierung – Pioneering for You. So wird aus Wasser Zukunft.

Mehr Informationen über Wilo unter: wilo.com
Warum integriertes Testen und Prüfen von KI und Cybersecurity zum Erfolgsfaktor werden.
Digitale Technologien sind heute in allen Lebensbereichen präsent: vom vernetzten Auto bis zur smarten Fabrik, vom intelligenten Zähler bis zur KI-App. Doch mit jeder Innovation steigen auch die Risiken. Softwarefehler können Sicherheitsfunktionen lahmlegen, Cyberangriffe Systeme blockieren und intransparente Algorithmen das Vertrauen untergraben. Gesetze wie der EU AI Act oder der Cybersecurity Act setzen neue Standards für Transparenz und Robustheit.
Gefragt sind Lösungen, die Silos überwinden: Funktionale Sicherheit, Cybersecurity und KI-Prüfung müssen auf einer ganzheitlichen Basis zusammenwirken, um integrierte Sicherheit zu gewährleisten. Besonders deutlich wird dies im Bereich Fahrerassistenz und Automatisierung. Frühes Testen verhindert teure Nacharbeiten und beschleunigt den
Markteintritt. Wer früh testet, vermeidet Nachbesserungen, spart Kosten und beschleunigt den Markteintritt wirksam. Wie ein solcher integrierter Ansatz aussieht, erläutert im Gespräch der CEO von DEKRA.
DEKRA hat seine Digital Trust Services vorgestellt. Warum gerade jetzt? Wir sind überall von KI-Technologien umgeben. Vom Smartphone über softwaredefinierte Fahrzeuge bis hin zu vernetzten Produkten und Services entwickeln sich Technologien exponentiell weiter. Autonome Systeme, vernetzte Mobilität, KI-Algorithmen und neue
Vertrauen muss auf allen Ebenen bestehen – von Sensoren und Chips über KI-Modelle bis zur Vernetzung.
Cyberbedrohungen entwickeln sich rasant. Wir bei DEKRA bündeln unter Digital Trust die Stärke von KI, die Widerstandsfähigkeit von Cybersicherheit sowie die Verlässlichkeit von Funktionaler Sicherheit. Wir sind überzeugt, dass integrale Sicherheit über alle Technologien hinweg notwendig ist, um Innovationen zuverlässig und gesellschaftlich tragfähig zu verankern.
Was unterscheidet Ihren Ansatz von anderen Anbietern? Viele Anbieter bieten Beratung oder einzelne Tests. DEKRA verfügt über mehr als 60 Testeinrichtungen und bleibt so nah am Markt und an den globalen regulatorischen Anforderungen. Der nächste logische Schritt: KI-, Cybersecurity- und Funktionale-Sicherheit-Tests, Evaluierung und Zertifizierung zu einem globalen Angebot verbinden. Dazu simulieren wir Angriffe und Sicherheitsfehler, testen KISysteme unter realen Bedingungen und Extremszenarien und verknüpfen dies mit regulatorischer Compliance. Diese

Seit 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung entwickelt. www.dekra.de/de/startseite
Kombination aus technischer Tiefe, physischer und virtueller Kapazität sowie Unabhängigkeit ist im globalen Testing, Inspection & Certification (TIC)-Markt einzigartig.
Welche Rolle spielt das bei ADAS und autonomen Funktionen?
Vertrauen muss auf allen Ebenen bestehen – von Sensoren und Chips über KI-Modelle bis zur Vernetzung. Wir testen, ob die KI unvoreingenommen und zuverlässig funktioniert, wir testen Fehlertoleranz bei Hardwaredefekten und prüfen, wie stabil wichtige Netzwerkelemente bei möglichen Schwachstellen bleiben. Gleichzeitig unterstützen wir Homologation und Typzulassung auf Teststrecken und im realen Verkehr.
Was haben Kunden konkret davon?
Digital Trust ermöglicht, Produkte sicher und schnell auf den Markt zu bringen –ohne unerwartete Rückschläge. DEKRA sorgt für die verlässliche Einhaltung internationaler Standards und umfassenden Schutz vor Risiken von Sicherheit und Cybersecurity bis hin zu KI – und sorgt dafür, dass Kunden resilient und zukunftsfähig bleiben.
Wie sichern Sie diese Position langfristig?
Wir investieren weltweit in Testfelder, Labore und Prüfgelände und erweitern unsere Expertise in KI, Cybersecurity und funktionaler Sicherheit. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern, Behörden, Normungsorganisationen und führenden Technologieunternehmen stärken wir regulatorische Angebote und bleiben an der Spitze der Innovation. Gleichzeitig wächst unser globales Expertenteam, sodass Kunden von lokaler Nähe und internationaler Perspektive profitieren.
Und was gibt es Neues aus dem Bereich der Elektromobilität?
Am Lausitzring haben wir ein Batterie Test Center eingerichtet. Dort werden Batterien umfassend vor dem Markteintritt geprüft. Für den Gebrauchtwagenmarkt nutzen wir ein patentiertes Schnellverfahren, das innerhalb von 15 Minuten verlässliche Informationen zum Zustand einer Traktionsbatterie liefert. Diese Transparenz schafft Vertrauen beim Kauf und Wiederverkauf.
Digital Trust ermöglicht, Produkte sicher und schnell auf den Markt zu bringen – ohne unerwartete Rückschläge.
Künstliche Intelligenz revolutioniert nicht nur die Technologie, sondern vor allem unsere Geschäftsmodelle. Deutsche Unternehmen haben alle Voraussetzungen, um im globalen KI-Rennen vorne mitzuspielen. Was fehlt, ist der Mut zum Umdenken.
Deutschland steht an einem Wendepunkt. Während ein Start-up binnen Monaten zum Unicorn werden kann, dauert die Umsetzung einer KI-Strategie in etablierten Konzernen oft Jahre. Diese Diskrepanz zeigt, dass nicht die Technologie uns bremst – es ist unsere Mentalität. Die gute Nachricht: Künstliche Intelligenz bietet deutschen Unternehmen die Chance, ihre Innovationsführerschaft zurückzuerobern. Die Technologie ist da: AWS Bedrock, Microsoft Azure AI, all das funktioniert heute schon hervorragend. Die entscheidende Frage ist, wie wir diese Möglichkeiten in konkrete Geschäftsmodelle übersetzen.

Wo früher Bauingenieure persönlich jede Baustelle inspizieren mussten, liefert die KI heute präzise Fortschrittsberichte in Echtzeit.
Von der Dampfmaschine zur Denkmaschine
Was die Dampfmaschine für körperliche Arbeit war, ist KI heute für kognitive Prozesse. Ein führender deutscher Automobilhersteller nutzt bereits Large Language Models als intelligente
Assistenten. Testingenieure, die früher tagelang komplexe Auswertungsformeln erstellten, erhalten heute binnen Minuten präzise Analysen ihrer Testdaten. Die KI versteht ihre Anfragen, interpretiert Informationen und liefert verwertbare Ergebnisse. Ein mittelständisches Bauunternehmen geht noch weiter. Mittels Drohnenaufnahmen und KI-gestützter Bildanalyse dokumentiert es automatisch den Baufortschritt von Infrastrukturprojekten. Wo früher Bauingenieure persönlich jede Baustelle inspizieren mussten, liefert die KI heute präzise Fortschrittsberichte in Echtzeit. Diese Beispiele kratzen nur an der Oberfläche dessen, was heute schon möglich ist und morgen zum Standard wird.

Der deutsche Perfektionismus als Chance Deutsche Unternehmen haben einen entscheidenden Vorteil: Sie verstehen ihr Handwerk wie kein anderer. Wir wissen, wie man Maschinen baut, komplexe chemische Prozesse steuert oder Kraftwerke konstruiert. Dieses tiefe Fachwissen können wir nun mit KI augmentieren, um Produktionsprozesse zu optimieren und repetitive kognitive Arbeit zu automatisieren. Die wahre Stärke der KI liegt darin, dass sie uns zusätzliche „Denkkapazität“ verschafft. Deutsche Ingenieure können ihre Detailverliebtheit nun voll ausleben: Mit KI-Unterstützung lassen sich tausende Parameter gleichzeitig optimieren, für die früher schlicht die Zeit oder die Fachkräfte fehlten. Wo wir bisher Kompromisse machen mussten, können wir jetzt selbst das kleinste Detail unter die KI-Lupe nehmen. Die KI wird zum unverzichtbaren Werkzeug für deutsche Präzisionsarbeit.
Vom Workshop zur Wertschöpfung Skaylink holt Unternehmen genau dort ab, wo sie stehen – und verbindet dabei deutsche Gründlichkeit mit agiler Innovation. Der Weg von der Idee zur Umsetzung folgt bei Skaylink einem bewährten Muster. Zunächst werden in interaktiven Workshops gemeinsam mit den Fachabteilungen konkrete Anwendungsfälle identifiziert. Dabei steht nicht die Technologie im Vordergrund, sondern die Frage, welche Geschäftsprozesse revolutioniert werden können. Die vielversprechendsten Ideen durchlaufen dann einen Proof of Concept in einem geschützten Rahmen, wo sich
Skaylink bringt Europas beste Experten für Cloud-Lösungen und die digitale Transformation zusammen. Ihre Kunden bekommen Beratung, Schulungen und praktische Unterstützung, damit sie in jeder Phase ihrer Cloud-Reise das Beste aus den Cloud-Technologien herausholen können. www.skaylink.com
schnell zeigt, was funktioniert. Drei schnelle Versuche sind dabei besser als jahrelange Planung. Erfolgreiche Prototypen werden schließlich schrittweise, aber konsequent in die Unternehmensrealität überführt.
Deutschland kann KI – wenn es will Die Beispiele zeigen, dass deutsche Unternehmen, die den Mut zur Veränderung aufbringen, mit KI ihre Wettbewerbsposition dramatisch verbessern können. Von der Prozessoptimierung über neue Kundenservices bis zur kompletten Neuerfindung von Geschäftsmodellen – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, die unsere Wirtschaft fundamental verändern wird. Die Frage ist nicht, ob KI kommt, denn sie ist schon da. Die Frage ist, wer sie nutzt, um die Zukunft zu gestalten. Deutschland hat alle Voraussetzungen, um im globalen KI-Rennen vorne mitzuspielen. Exzellente Fachkräfte, tiefes Domänenwissen und eine starke Industrie. Was es jetzt braucht, ist der Mut, gewohnte Pfade zu verlassen. Die Technologie wartet nicht. Die Konkurrenz auch nicht.
Deutschland hat alle Voraussetzungen, um im globalen KI-Rennen vorne mitzuspielen. Exzellente Fachkräfte, tiefes Domänenwissen und eine starke Industrie.
GRÜNDERGEIST
Geförderte KI-Start-ups beschleunigen Prozesse, schaffen Jobs und öffnen neue Märkte – doch Finanzierungslücken und Regulierung bremsen häufig den Weg nach vorn. Wie Deutschland hier den Anschluss hält, weiß Dr. Tina Klüwer, KI-Expertin und Autorin.
Text:Thomas Soltau Foto: Presse, Startup Stock Photos/pexels
Woran messen Sie den Produktivitäts- und Wettbewerbshebel geförderter KI-Start-ups?
Der Produktivitätshebel geförderter KI-Start-ups zeigt sich daran, ob ihre Technologien in der Praxis Wirkung entfalten. Wenn Prozesse schneller ablaufen, Kosten sinken, Umsätze steigen oder die Zeit bis zur Marktreife verkürzt wird, entsteht klarer Mehrwert. Solche Effekte lassen sich an Kennzahlen wie Nutzungshäufigkeit oder Kundenbindung belegen. Darüber hinaus haben KI-Start-ups aber einen volkswirtschaftlichen Wert: Sie schaffen Arbeitsplätze und generieren Steuereinnahmen, und vor allem treiben sie Innovationen voran und formen neue Märkte. Dieser Effekt ist schwerer zu quantifizieren, aber von großer Bedeutung.
Welche Finanzierungslücke ist aktuell für DeepTech-Start-ups am kritischsten: Seed, Series A oder Growth? DeepTech-Start-ups in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, oder Biotechnologien benötigen oft jahrelange Entwicklungsarbeit, bevor ihre Produkte marktreif sind. Für klassische Wagniskapitalgeber sind sie in dieser Phase wenig attraktiv, sodass vielen Gründungsteams in dieser frühen Phase die Finanzierung ausgeht. Um diese Lücke zu schließen, wurde der Zukunftsfonds ins Leben gerufen, der junge Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf unterstützen soll. Aber
auch die heimischen Investoren werden offener für Deep-Tech-Themen. Im Vergleich bleibt Deutschland jedoch zurück. Häufig nehmen Teams daher Kapital aus dem Ausland auf – nicht selten verbunden mit der Verlagerung des Firmensitzes. Das entzieht dem Standort wichtige Innovationstreiber und schadet langfristig der deutschen Wirtschaft.
Erleichtert der EU AI Act Gründungen durch Klarheit – oder bremst er junge Teams? Der EU AI Act schafft Vertrauen, was auch Start-ups grundsätzlich zugutekommt. Gleichzeitig erschwert er den Marktzugang, da Regulierung immer Aufwand bedeutet. Ablehnung gegenüber Regulierung sehe ich bei Start-ups so gut wie nie; sie wollen Kunden und Nutzer schützen. Problematisch wird es aber, wenn ein deutsches Start-up ein
DeepTech-Startups in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, oder Biotechnologien benötigen oft jahrelange Entwicklungsarbeit, bevor ihre Produkte marktreif sind.

Der EU AI Act schafft Vertrauen, was auch Start-ups grundsätzlich zugutekommt.
halbes Jahr länger für die Markteinführung braucht als ein internationaler Wettbewerber, da es Ressourcen in die Erfüllung der Regulierung stecken muss. Das kann zum Wettbewerbsnachteil werden. Vereinfachte Zertifizierungswege für junge Teams können eine Lösung sein.
Was aus den K.I.E.Z-Programmen sollte die Bundespolitik jetzt bundesweit skalieren?
K.I.E.Z hat, neben einem erfolgreichen Accelerator für KI-Start-ups, Angebote für Forschende aufgebaut, die den Sprung in die Gründung wagen wollen. Forschung und kommerzielle Nutzung der Ergebnisse stehen in Deutschland aktuell leider nicht im Verhältnis: Es gibt viel gute Forschung,
aber die Ergebnisse werden nicht gewinnbringend eingesetzt. Gründe sind fehlender Austausch zwischen Unternehmen und Wissenschaft sowie hohe Hürden für den Übergang in die unternehmerische Praxis. Hier braucht es Anreize und Unterstützung, damit mehr Forschungsergebnisse den Weg in Produkte oder Geschäftsmodelle finden. Das stärkt die deutsche Wirtschaft und sichert langfristig Wohlstand und Arbeitsplätze.
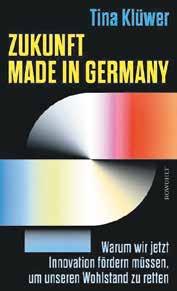
Buchtipp Die umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands heißen VW, Allianz, Mercedes-Benz, BMW und E.ON. In den USA (und der Welt) sind es Apple, Microsoft, Amazon, Tesla und Google. Das Dilemma der deutschen Wirtschaft ist klar: Wir brauchen dringend frischen Wind!
„Zukunft made in Germany – Warum wir jetzt Innovation fördern müssen, um unseren Wohlstand zu retten“ von Wirtschaftsexpertin Tina Klüwer erzählt auf 174 Seiten, wie es gelingt, bei neuen Technologien an der Weltspitze mitzumischen. Preis: 24,00 EUR
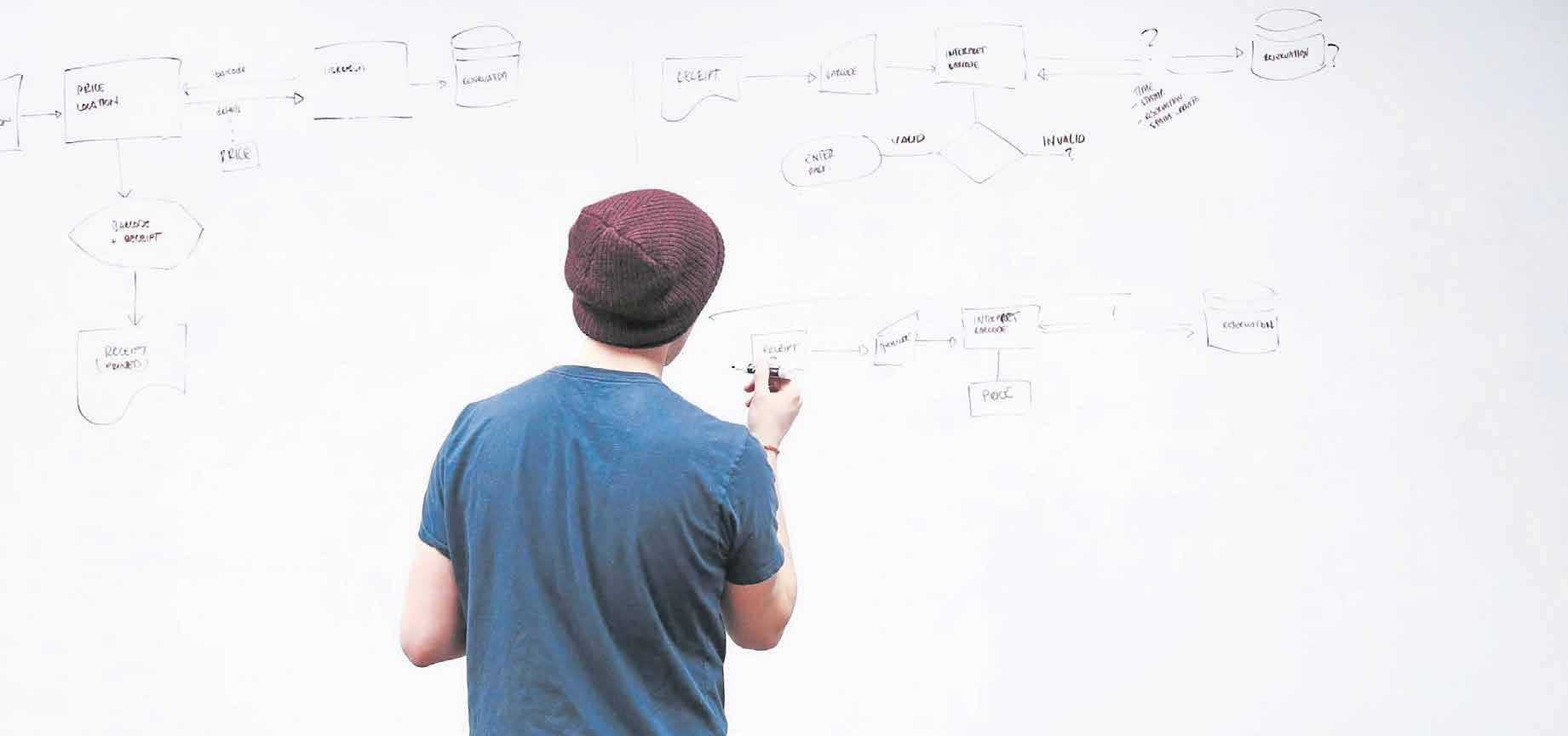

Die Fertigungsprozesse in der Automobilindustrie haben in den vergangenen Jahren eine dynamische Entwicklung durchlaufen. Digitale Hilfsmittel kamen zunächst vor allem aus Sicherheitsgründen zum Einsatz, zum Beispiel zur Ortung von Mitarbeitenden, die alleine arbeiten. Heute entfalten sie ihren Nutzen besonders in Logistik und Produktidentifikation, etwa durch smarte Handschuhe, die Barcodes und Smarttags direkt erkennen.
Auch in der Qualitätssicherung gewinnen sensorbasierte Systeme zunehmend an Bedeutung: Datenbrillen oder andere tragbare Geräte erfassen Arbeitsprozesse in Echtzeit und unterstützen die Mitarbeitenden. Parallel dazu wächst die Komplexität der Produktion, denn Multi-Customizing sorgt dafür, dass nahezu jedes Fahrzeug individuell gefertigt wird. Diese Vielfalt erhöht die Anforderungen an die manuelle Montage und birgt das Risiko, einzelne Prozessschritte oder Bauteile zu übersehen. Um dieser Herausforderung zu begegnen, rücken digitale Assistenzsysteme verstärkt in den Mittelpunkt. Sie helfen, Sicherheit, Effizienz und Qualität gleichermaßen zu gewährleisten.
Dr. Thomas Röthig, CEO der VOSS Automotive GmbH, spricht über seinen neuen KI-gestützten Sensorhandschuh ClickID. Das System überwacht manuelle Montageprozesse mit smarten Sensoren, erkennt akustische Signale („Clicks“) und Bewegungsabläufe, analysiert sie per KI in Echtzeit und gibt Feedback an die Arbeiter. So steigt die Prozessqualität, während die Fehlerquote um bis zu 80 Prozent sinkt.
Dr. Röthig, welche konkreten Probleme in der Montage können Sie mit ClickID lösen?
Wearables werden in der Automobil-
industrie noch nicht flächendeckend eingesetzt, bieten aber großes Potenzial, insbesondere in der manuellen Montage, die zunehmend komplexer und fehleranfälliger wird. Unser leichtes, kabelloses Wearable ClickID erfasst die typischen Bewegungsmuster mittels Sensorik und KI und erkennt frühzeitig Fehler, z. B. bei der Montage von elektrischen und fluidischen Steckverbindungen, Halteklipsen oder Schellen. Es gibt der tragenden Person Feedback in Echtzeit und ermöglicht bei Einbaufehlern sofortige Korrektur. So werden Fehlmontagen vermieden, bevor sie im weiteren Prozess teure Folgen haben. Ausgangspunkt war die Automobilindustrie, die Technologie lässt sich jedoch auch auf andere Branchen mit händischen Montageprozessen übertragen.
Wearables werden in der Automobilindustrie noch nicht flächendeckend eingesetzt, bieten aber großes Potenzial, insbesondere in der manuellen Montage, die zunehmend komplexer und fehleranfälliger wird.

Dr. Thomas Röthig, CEO der VOSS Automotive GmbH
Wie funktioniert die Einarbeitung von ClickID bei einem Neukunden?
Die Einarbeitung ist der Kern unseres fünfstufigen Implementierungsprozesses. Sie beginnt mit dem Anlernen direkt vor Ort: Wir beobachten die Abläufe und erfassen Daten. Daraufhin wird das kundenspezifische KI Modell trainiert, um korrekte von fehlerhaften Montagen zu unterscheiden – meist innerhalb weniger Stunden und oft schon beim ersten Besuch. Besonders effektiv ist das Wearable in Kombination mit bestehenden Produktionssystemen. Hier arbeiten unsere Softwareexperten mit Integratoren zusammen, die Schnittstellen bereitstellen, sodass sich Wearables und KI-Modelle kontinuierlich an aktuelle Prozesse anpassen sowie die Kommunikation mit den Kundensystemen gewährleisten.
Wie wird ClickID von der Belegschaft akzeptiert?
Besonders die technikaffinen Werker stehen der Technologie sehr positiv gegenüber, manche fühlen sich damit sogar wie „Iron Man“. Vereinzelt gibt es Angst vor Mitschnitten, diese ist aber unbegründet, da der Handschuh keine Sprachinhalte erfasst. Sobald der praktische Nutzen sichtbar wird, etwa durch grünes Aufleuchten bei korrekt
Als mittelständische Unternehmensgruppe entwickelt und produziert VOSS Leitungs- und Verbindungssysteme für die Automobilindustrie sowie den Maschinen- und Anlagenbau. www.voss.net
Moderne Industrie setzt darauf, die Flexibilität des Menschen mit intelligenten Systemen zu verbinden, was Produktivität, Qualität und Arbeitsplatzaufwertung steigert.
ausgeführten Aufgaben, überwiegen Begeisterung und Offenheit deutlich.
Wird es in Zukunft eine noch engere Kombination von Menschen, Maschinen und KI in der Produktion geben? Ja, auf jeden Fall. ClickID ist nur eine unserer entwickelten Innovationen. Es ist Teil unserer Strategie, sich als verlässlicher Partner für eine smarte Produktion aufzustellen. Wearables und auch der Einsatz von KI gewinnen zunehmend an Bedeutung, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in Logistik und anderen Bereichen, zum Beispiel durch AR-Brillen, die Mitarbeitende bei der Teileentnahme unterstützen. Moderne Industrie setzt darauf, die Flexibilität des Menschen mit intelligenten Systemen zu verbinden, was Produktivität, Qualität und Arbeitsplatzaufwertung steigert. Ein Zukunftsfeld ist die Zusammenarbeit mit kollaborativen Robotern („Cobots“), die über Sensorhandschuhe schnell und sicher angelernt werden können. Sie sind bereits heute in zahlreichen Bereichen etabliert und ihr Einsatz wächst rasant.

Menschen probieren für ihr Leben gern Neues aus. Ob beim Hype um ein neues iPhone oder beim Testen innovativer KI-Tools, die Faszination für das „neue glänzende Spielzeug“ treibt Menschen und Unternehmen gleichermaßen an. Doch während KI-Lösungen immer schneller auf den Markt drängen und Mitarbeitende zunehmend mit unterschiedlichsten Geräten und Apps arbeiten wollen und müssen, geraten wichtige Sicherheitsprinzipien schnell ins Hintertreffen. Studien zeigen, dass bereits 91 Prozent der Unternehmen bei der Einführung von KI riskante Sicherheitskompromisse eingehen. Vor allem fehlende Leitplanken, schwache Zugriffskontrollen und ungepatchte Systeme können sich in potenzielle Einfallstore für Angreifer verwandeln. Wer das Innovationspotenzial von KI sicher nutzen will, muss daher zuerst eine stabile Sicherheitsbasis schaffen mit robusten Cybersicherheitsrahmen, streng definierten Zugriffsrichtlinien und vor allem einem Bewusstsein für Risiken bei allen Mitarbeitenden – ob vor Ort, im Homeoffice oder auf Workation.
Auch NinjaOne, ein US-amerikanisches IT-Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Austin, Texas, beschäftigt sich mit dem Thema KI. Die zunehmende Verbreitung generativer KI zwingt Unternehmen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, wo und wie KI sinnvoll eingesetzt und optimiert werden kann, und vor allem, wie dabei Sicherheit gewährleistet wird. Sicherheitsorientiertes Denken ist im KI-Zeitalter längst kein „Nice-to-have“ mehr, sondern Grundvoraussetzung, um das volle Potenzial der Technologie langfristig zu nutzen.
Während früher primär die IT-Abteilungen für Sicherheit verantwortlich waren, ist sie heute eine gemeinsame Aufgabe der gesamten Organisation. Alle sind beim Einsatz neuer KI-Tools jetzt gefragt, Sicherheitsaspekte mitzudenken.
KI-gestützte Automatisierung kann zwar Prozesse wie Scripting oder Patch-Management beschleunigen, birgt jedoch erhebliche Risiken, wenn sie unkontrolliert eingesetzt wird. Ein nachhaltiger Ansatz ist daher, KI gezielt zur Unterstützung menschlicher Entscheidungen zu nutzen, zum Beispiel, um Schwachstellen und Trends zu identifizieren und Prioritäten zu setzen, während die finale Entscheidung in menschlicher Hand bleibt.
Gut implementiert bietet KI enorme Chancen: Sie automatisiert Routineaufgaben wie Datenerhebung oder Troubleshooting und schenkt Mitarbeitenden so 15 bis 20 Prozent mehr Zeit für Innovation, Lernen und kreative
Gerade angesichts verteilter Arbeitsmodelle und der wachsenden Vielfalt an Endgeräten ist ein effizientes und sicheres Endpoint-Management unverzichtbar, da neun von zehn Sicherheitsvorfällen an Endpunkten beginnen.
Projekte – jeden Tag. Das steigert Effizienz, Produktivität und fördert die berufliche Entwicklung, besonders für Berufseinsteiger:innen, die mit KI sofort auf höherem Niveau arbeiten können. Unternehmen profitieren doppelt: von leistungsfähigeren Teams und motivierten Mitarbeitenden, die KI als selbstverständliches Werkzeug erwarten.
Hier unterstützt NinjaOne: Die Plattform automatisiert die komplexesten Aufgaben im IT-Bereich, nämlich das Management der Geräte, auf denen Unternehmen laufen: Laptops, PCs, Tablets, Smartphones, IoT-Geräte und POS-Systeme. Gerade angesichts verteilter Arbeitsmodelle und der wachsenden Vielfalt an Endgeräten ist ein effizientes und sicheres Endpoint-Ma -
nagement unverzichtbar, da neun von zehn Sicherheitsvorfällen an Endpunkten beginnen.
Mit seiner cloudbasierten, skalierbaren und benutzerfreundlichen Plattform unterstützt NinjaOne inzwischen mehr als 30.000 Unternehmen in über 130 Ländern. Zu den Kernfunktionen zählen automatisiertes Endpoint- und Patch-Management, Mobile-DeviceManagement (MDM), Remote-Zugriff, Back-up- und Recovery-Lösungen sowie zentrale Dokumentation.
Für Organisationen mit Remote-Workforces ist NinjaOne besonders attraktiv: Die Plattform ermöglicht zentralisiertes Gerätemanagement, nahtlosen RemoteSupport und starke Sicherheitsfunktio -
Die Plattform ermöglicht zentralisiertes Gerätemanagement, nahtlosen RemoteSupport und starke Sicherheitsfunktionen.
nen. So lassen sich Geräte weltweit überwachen, absichern und warten – ohne hohe Kosten oder große ITTeams. Unternehmen können dadurch nicht nur ihre Sicherheit verbessern, sondern auch die Produktivität und Effizienz ihrer IT-Abteilungen steigern.
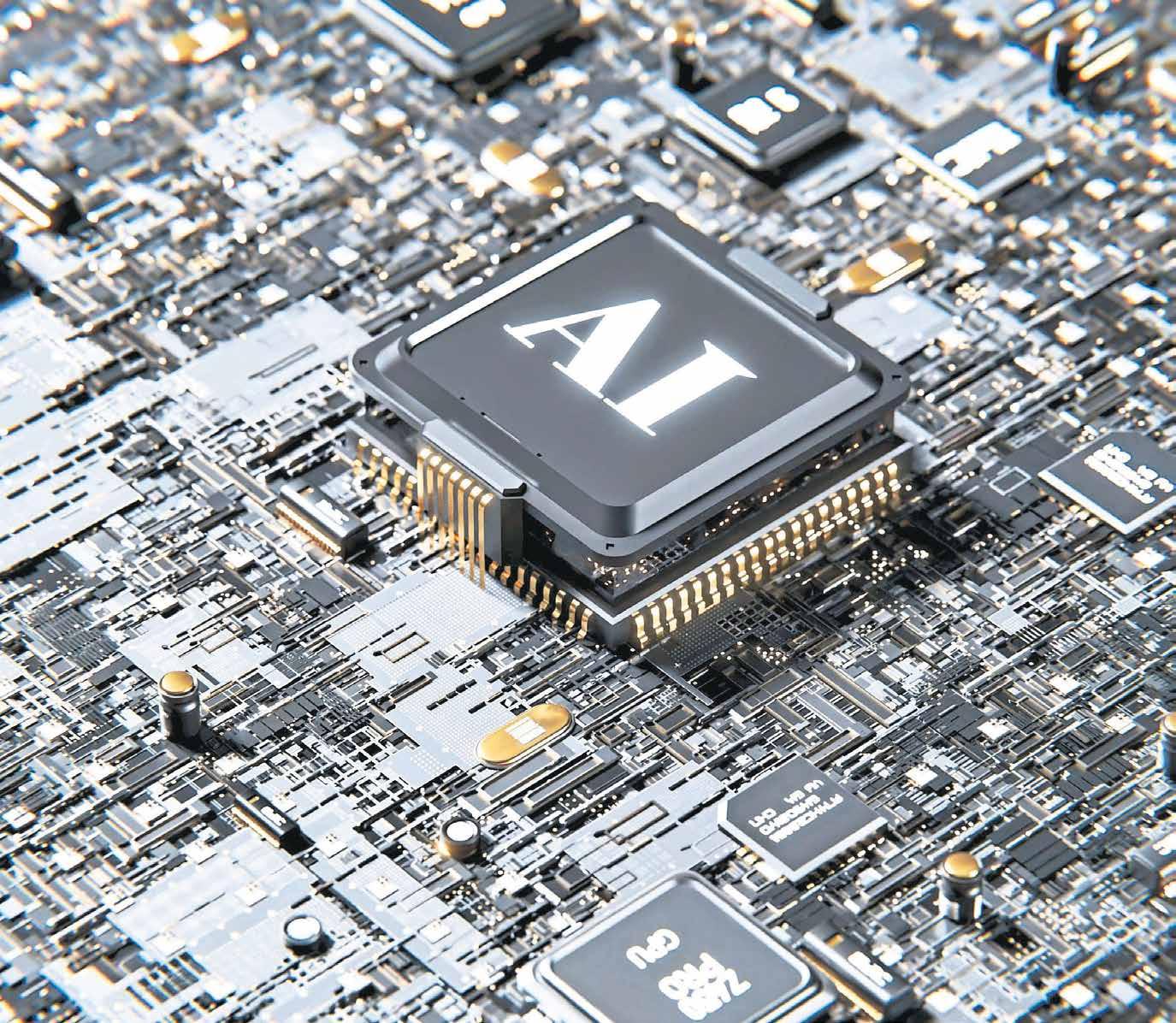
Weitere Informationen zu NinjaOne unter: www.ninjaone.com/de
HEALTHCARE
KI-Expertin Prof. Dr. Ariel Dora Stern über die Notwendigkeit digitaler Weiterbildung, Klinik-Hürden und wie KI die Versorgung menschlicher macht.
Text:

Prof. Dr. Ariel Dora Stern, Alexander von Humboldt Professorin für Digital Health, Economics and Policy am Hasso-Plattner-Institut (HPI), an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät des HPI und der Universität Potsdam.
Frau Prof. Dr. Stern, wie kann KI das deutsche Gesundheitswesen entlasten und wo sehen Sie Anwendungsbereiche?
KI, Telemedizin und digitale Anwendungen eröffnen über die Automatisierung administrativer Aufgaben hinaus einen für mich noch viel wichtigeren Ansatzpunkt: neue Wege für eine Patienten-zentriertere Versorgung. Immer mehr Diagnosen und Behandlungen, die bisher zwingend im Krankenhaus oder in der Praxis stattfinden mussten,
können dank digitaler Technologien auch zu Hause erfolgen. Dass vieles noch stationär geschieht, liegt oft nur daran, dass es schon immer so gemacht wurde – nicht, weil es medizinisch unbedingt notwendig ist. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist das Telemonitoring für Herzinsuffizienz-Patienten. Hier kommen implantierte Geräte zum Einsatz, die digital und per Bluetooth steuerbar sind. Sie messen kontinuierlich den Druck im Herzen und schlagen Alarm, wenn sich kritische Veränderungen abzeichnen. Diese Technik hat viele Leben gerettet. Aber wir sind inzwischen einen großen Schritt weiter und können denselben Effekt auch nicht-invasiv erzielen, allein durch KI-gestützte Sprachanalysen am Smartphone. Die Algorithmen erkennen feinste Veränderungen in der Stimmlage des Patienten, können den Gesundheitszustand beurteilen und vorhersagen, wer intensiver behandelt werden oder ins Krankenhaus kommen sollte, und das ohne etwas zu implantieren, nur über das eigene Smartphone.
Darin zeigen sich zwei Trends: Erstens, Telemonitoring und Hospital@Home ersetzt zunehmend Versorgung in der Praxis oder Klinik durch die digitale Betreuung zu Hause. Denn was in der Versorgung häufig nur Beobachtung und Messung über mehrere Tage bedeutet, lässt sich heute auch per Video und KIAlgorithmen abbilden – und das sogar präziser. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen ist das eine enorme Entlastung, da sie nicht mehr regelmäßig den Weg in die Praxis auf sich nehmen müssen und die notwendige medizinische Begleitung in ihrem vertrauten Umfeld erhalten. Zweitens: wir brauchen oft dazu kein zusätzliches medizinisches Gerät, das eigene Smartphone reicht.
Wo liegen die Hürden in der Implementierung von KI-Tools?
Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Herausforderungen. Zunächst gelten KI-Anwendungen in Diagnostik oder Therapie oft als Medizinprodukte und benötigen eine Zulassung. Davon hängt alles Weitere ab: Ob Investoren Mittel bereitstellen, Prototypen entstehen und ein Produkt überhaupt eine Chance bekommt. Solange eine Zulassung unklar ist, geht die Investitionsbereitschaft gegen Null, selbst wenn die Nachfrage groß
und die Lösung medizinisch sinnvoll ist. Natürlich sichern Regulierungen die Qualität jedes Medizinproduktes, sie machen die Einführung neuer KI-Tools aber komplexer und vielleicht auch langsamer, im Vergleich zu anderen Branchen.
Die nächste Herausforderung zeigt sich nach der Zulassung. Denn diese bedeutet längst nicht, dass ein Tool automatisch in den Kliniken eingesetzt wird. Entscheidend ist die Erstattung durch die Krankenkassen. Viele digitale Anwendungen werden den Kliniken…
Lesen Sie den ganzen Artikel online auf: contentway.de
Fakten
Digitalisierung und KI sind eng miteinander verbunden: Die Digitalisierung schafft die notwendige Infrastruktur und Datenbasis. KI nutzt diese Daten zur Analyse, um Diagnosen präziser zu gestalten, Therapien individueller und bequemer zu machen und administrative Prozesse effizient zu automatisieren.
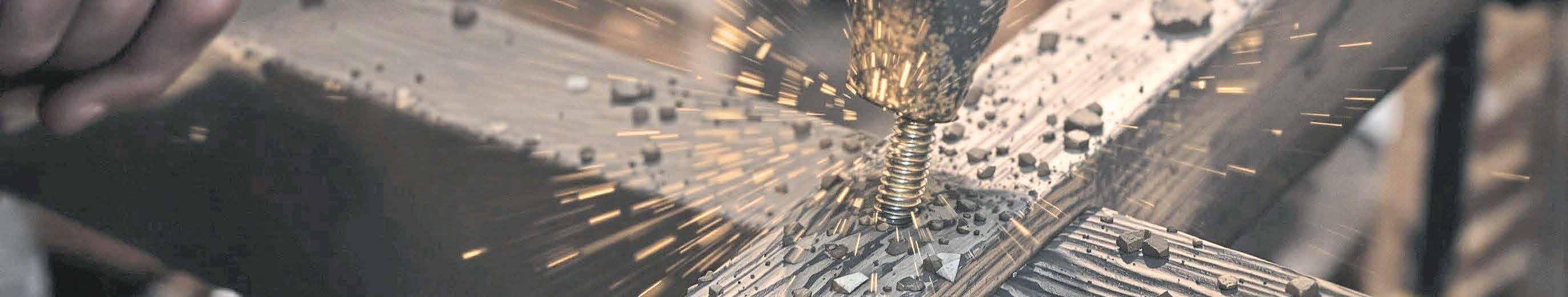
Hoch lebe die KI! –Ein Aufruf zu maßvollem Umgang
Mjölnir, der Hammer von Thor, ist eine mächtige Waffe in der nordischen Mythologie, mit der sich in eben jener Mythologie sämtliche Probleme lösen lassen. In unserer Welt haben wir generative Sprachmodelle, denen mittlerweile ähnliche Fähigkeiten zugeschrieben werden. Es ist geradezu erschreckend zu sehen, wie innerhalb weniger Jahre die hohen Qualitätsstandards in der Medizin fast über den Haufen geworfen werden. Fast täglich entstehen Angebote, die immer tiefer in Behandlungsprozesse eingreifen. Die Medizinprodukteverordnung, das KI-Gesetz, die DGSVO und Haftungsfragen werden dabei mit – man muss es so nennen – frisierten Zweckbestimmungen und fadenscheinigen Begründungen regelrecht missachtet.
Und die Anwender – Ärzte, Apotheker, Pflegekräfte und Entscheider – glauben nur allzu gern den Versprechungen der Anbieter. Denn der Druck ist groß und damit auch die Hoffnung auf eine schnelle und einfache Lösung. Das Problem ist aber viel tiefer verwurzelt, als wir uns es oft eingestehen wollen. Das Behandler immer weniger Zeit haben, sich um Patienten zu kümmern ist letztlich
nur ein Symptom und lässt sich als solches auch nur „KI-kaschieren“. Wir bewegen uns einerseits in antiquierten Strukturen – die Aufzählung der im deutschen Gesundheitssystem verankerten Institutionen würde nicht auf diese Seite passen – und erzeugen auf der anderen Seite lediglich „digitalen Papierkram“. Die ePA – die elektronische Patientenakte – steht mal wieder vor der Tür; wie eigentlich schon seit 10 Jahren. Diesmal kommt allerdings sie wohl wirklich. Aber statt einer ganzheitlichen und vor allem strukturierten Lösung wie in unseren Nachbarländern, wird sie wohl vor allem PDF-Dokumente enthalten. Die müssen geschrieben und gelesen werden. Und wenn wir das den Sprachmodellen überlassen, dann geben wir letztlich die Medizin aus der Hand.
Bei einer differenzierten Betrachtung muss man aber auch anerkennen, dass es äußerst hilf- und erfolgreiche Ansätze gibt. Einerseits im Bereich der wissensbasierten Expertensysteme aber auch im Bereich der datengetriebenen Modelle. Die ganzheitliche Analyse der medikamentösen Therapie ist heute in vielen deutschen Kliniken ein standardisierter Prozess, der als Medizinprodukt
verlässliche und vorhersagbare Qualität liefert. Im Bereich der datengetriebenen Ansätze sind hier sicherlich alle Formen der Komplikationsprädiktion zu nennen: vom Delir bis zur Sepsis. Eines haben aber alle Lösungen gemeinsam: sie arbeiten auf hochstrukturierten Daten!
Und natürlich haben auch Sprachmodelle ihre Stärken: insbesondere bei der Erzeugung von Texten aus – ja! – strukturierten Daten können sie eine erhebliche Erleichterung darstellen, denn schließlich wurden die Modelle einst genau dafür entwickelt. Aber auch bei der Wissensvermittlung – wohl gemerkt nicht der Erzeugung – zeigen diese Modelle immer wieder erhebliches Potenzial und machen so aus einem guten Arzt einen sehr Guten.
Wir bei ID Berlin digitalisieren das Gesundheitssystem, indem wir semantisch interoperable Daten erzeugen und Expertensysteme anbieten, die auf diesen Daten basieren.
Mehr Informationen über ID Berlin unter: www.id-berlin.de
Nach der ersten Experimentierphase mit KI stehen viele Unternehmen vor entscheidenden Weichenstellungen. Sollen sie Modelle selbst trainieren oder besser vorgefertigte Varianten nutzen? Wo liegt der richtige Ort für die Inferenz – in der Cloud, im Rechenzentrum oder bei Hyperscalern? Und wie lassen sich dabei Kosten, Sicherheit und Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern im Griff behalten?
Solche Fragen prägen aktuell den Alltag von IT- und Fachabteilungen, die KI-Anwendungen nicht nur entwickeln, sondern auch zuverlässig betreiben müssen. Wie Red Hat diese Fragen beantwortet und welche Entwicklungen für die Zukunft das Unternehmen sieht, darüber haben wir mit Gregor von Jagow, Country Manager Germany bei Red Hat, gesprochen.












Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, ihre GenAI- und LLM-Projekte effizient und sicher in den Betrieb zu überführen. Auf welche Lösungen kommt es aus Ihrer Sicht dabei an?
Wir brauchen unbedingt leistungsfähige Open-Source-Lösungen, die auf Transparenz, Interoperabilität und Unabhängigkeit aufbauen. Aus diesem Grund haben wir mit Red Hat AI einen Ansatz entwickelt, der moderne Container- und Cloud-Technologien mit einem Ökosystem an Werkzeugen und Modellen verbindet. Damit steht Unternehmen alles zur Verfügung, um ihre KI-Anwendungen zu entwickeln, zu trainieren und schließlich auch zu betreiben –ohne an einen Hyperscaler oder eine bestimmte Infrastruktur gefesselt zu sein.
Viele Unternehmen starten dabei mit Pilotprojekten, stoßen aber schnell auf Skalierungsprobleme. Wie will Red Hat dabei helfen, den wirtschaftlich sinnvollen Übergang von der Trainingsphase in den stabilen Betrieb zu meistern?
Pilotprojekte sind meist schnell aufgesetzt, haben in der Realität mit dem Produktivbetrieb aber wenig zu tun. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen. Mit unseren vorgefertigten OpenSource-Modellen können Unternehmen erste Ergebnisse erzielen und diese Modelle mit eigenen Daten schrittweise weiterentwickeln. Gleichzeitig bieten unsere umfangreichen Trainingsressourcen und Schulungen die notwendige Kompetenz, um Projekte aus der


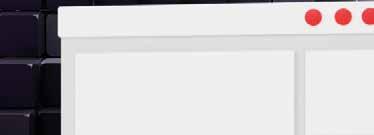




Test-Umgebung in produktive Systeme mit einer sinnvollen Hosting-Strategie und Inferenz-Servern zu überführen. Das reduziert Reibungsverluste, beschleunigt Time-to-Value und sichert Langlebigkeit sowie Innovationsgeschwindigkeit.


Sie betonen die Bedeutung der Hosting-Strategie und Inferenz. Warum sind gerade diese Aspekte entscheidende Faktoren für den produktiven Einsatz von KI – und wie unterstützt Red Hat hier?
Im Alltag entscheidet die Inferenz, also das Ausführen trainierter Modelle, über Kosten, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von KI-Anwendungen. Wer ausschließlich auf proprietäre Dienste setzt, läuft Gefahr, Kostenexplosionen und Leistungslücken in Kauf zu nehmen. Mit unseren Open-Source-Lösungen haben wir hingegen die Möglichkeit, Inferenz unabhängig und flexibel zu machen – ob im eigenen Rechenzentrum, in der Cloud oder hybrid. Durch eine containerbasierte Architektur können Unternehmen Workloads dorthin verschieben, wo sie am effizientesten laufen. Das senkt nicht nur Betriebskosten, sondern stärkt auch die eigene Souveränität.
Wohin entwickelt sich das Thema Open-Source-Inferenz aus Ihrer Sicht – und welche Rolle will Red Hat dabei im Ökosystem spielen?
Wir sind überzeugt, dass ein Open-Source-Ansatz langfristig der Schlüssel zu einer flexiblen und effizienten Nutzung von GenAI und LLMs ist. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir hier eine ähnliche Entwicklung wie bei Linux erleben und Open Source sich als Rückgrat von Inferenz-Lösungen etabliert – egal, ob in der Cloud, On-Premises oder als hybride Lösung. Die Vorteile dieser Wahlfreiheit sind auch ein Schwerpunkt auf dem Red Hat Summit: Connect in Darmstadt 2025, wo wir zeigen werden, wie Unternehmen Open Source bei der Inferenz in der Praxis einsetzen können. Unser Ziel ist es KI-Innovationen nicht nur zu diskutieren, sondern greifbar zu machen.
Jetzt zum Red Hat Summit: Connect 2025 anmelden
