LESE PROBE
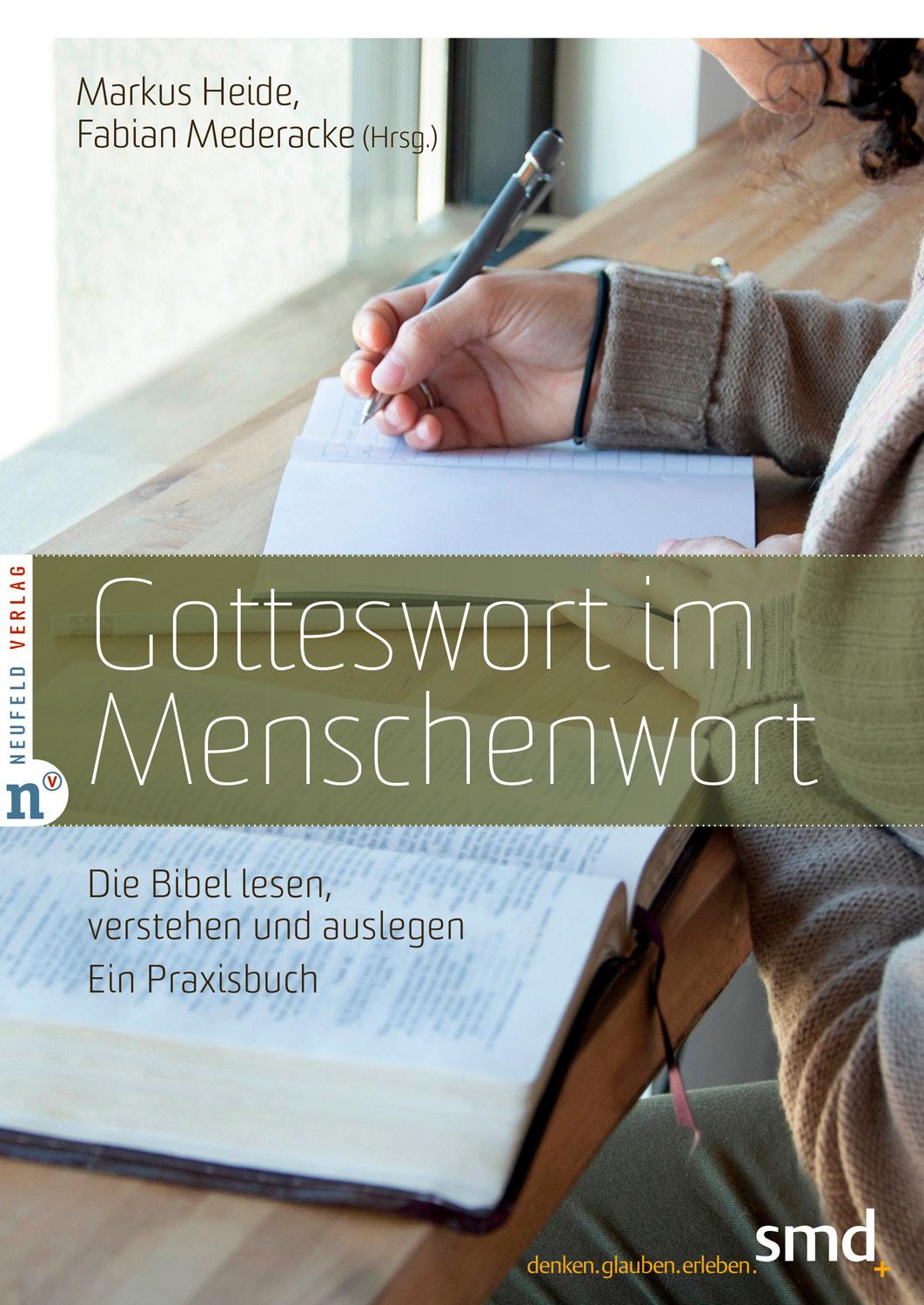

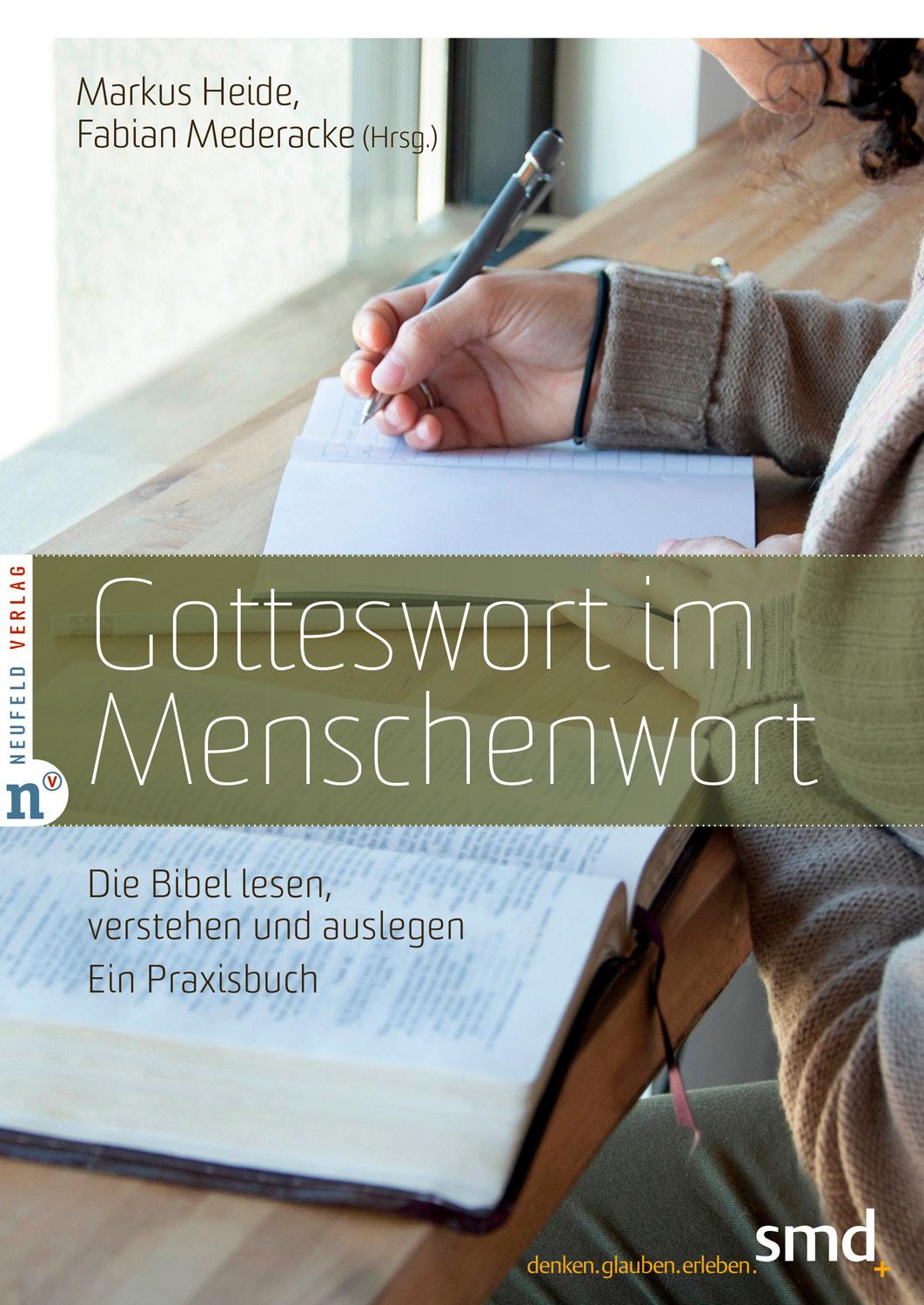
Die Bibel lesen, verstehen und auslegen
Herausgegeben von Markus Heide und Fabian Mederacke
NEUFELD VERLAG
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der SMD , dem Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und akademischer Berufswelt www.smd.org
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar
Bibelzitate, soweit nicht anders angegeben, wurden der Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, entnommen
Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson Umschlagabbildung: PureRadiancePhoto, shutterstock.com
Satz: Neufeld Verlag
Herstellung: CPI – Clausen & Bosse, Birkstraße 10, 25917 Leck © 2021 Neufeld Verlag, Sauerbruchstraße 16, 27478 Cuxhaven ISBN 978-3-86256-175-9, Bestell-Nummer 590 175
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages www.neufeld-verlag.de
Bleiben Sie auf dem Laufenden: newsletter.neufeld-verlag.de www.facebook.com/NeufeldVerlag www.neufeld-verlag.de/blog
6. Gott spricht durch die Bibel: Warum hören wir
10. Von den Texten zu unserem Handeln – vier Schritte
11. Wie komme ich von einem Text zu einer begründeten ethischen
In manchen Ländern wird die Bibel gehandelt, als wäre sie eine Handgranate im Bücherregal. Aber keine Angst: ungelesen ist sie völlig harmlos. Mahatma Gandhi, der indische Freiheitskämpfer, soll einmal über die Bibel gesagt haben: „Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts.“ Gandhi hatte eine tiefe Wertschätzung gegenüber dem christlichen Glauben und der Bibel. Sein gewaltloser Widerstand gegen die britischen Kolonialherren war stark inspiriert von den Worten und Taten von Jesus.
Der christliche Glaube zieht seine Kraft aus der Bibel. Nirgendwo anders begegnet uns Gott so klar. Nirgendwo sonst erfahren wir so unzweifelhaft von seiner tiefen Liebe zu uns Menschen. Wie sonst wüssten wir etwas vom Leben, Lehren, Heilen, Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus, dem Christus, dem „Gott-für-uns“?
Zugleich fällt Bibellesen nicht nur uns heute schwer. Das war es wohl zu allen Zeiten. Gottes Wort redet so ganz anders als die vielen Stimmen unserer Zeit.
Aber was ist das eigentlich: Gottes Wort? Was in der Bibel ist Gottes Wort? Und was haben uns Worte der Propheten heute zu sagen? Gilt es uns? Wie gilt es uns? Und wie kann man das übersetzen ins Heute?
Leicht führen solche Fragen dazu, dass ich die Bibel im Regal lasse: zu kompliziert! Aber dann verpasse ich das Wesentliche: Gott spricht. Heute.
Wir müssen nur einüben zu hören.
Das ist wie beim Surfen. Es sieht so leicht aus, die Kraft der Welle zu nutzen und auf ihr zu reiten. Dynamisch. Kraftvoll. Fast schwerelos. Aber damit das gelingt, muss man üben, die Welle zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu nehmen. Sich von ihrer Kraft mitnehmen zu lassen. Entspannt und mit gutem Stand die Welle zu surfen. Je länger ich es übe, desto
besser kann ich die Wellen „lesen“ und ihre Kraft nutzen, um mich davon weit tragen zu lassen.
So ist es mit dem Bibellesen. Je mehr ich es übe, um so mehr Reichtum entdecke ich in der Bibel. Ich werde heimisch in ihr. Und sie wird mir lieb und teuer. Dann begegnet mir in ihr Gott, der spricht. Zu mir. In den alten Geschichten.
Eine Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott im Lesen der Bibel kann das folgende Gebet sein, das mit alten Worten beginnt:
Großer Gott, lieber Herr, gib mir ein Herz für dein Wort und ein Wort für mein Herz.
Ich kenne dich so wenig und behaupte, dich zu lieben.
Ich möchte dich kennen und darum in deinem Wort nach dir suchen.
Begegne mir in deinem Wort. Lehre mich, es zu lesen und darin dich und mich zu finden.
Rede du.
Zu mir.
Und lass mich horchen und gehorchen.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht (Ps 36,10).
Dieses Praxisbuch will dir beim „Üben“ helfen. Mit klugen Gedanken von früher und heute. Mit praktischen Hilfsmitteln. Und mit der Einladung, die Bibel voll Freude und Erwartung in die Hand zu nehmen. Aber Vorsicht: Sie könnte dich verändern. Du könntest ihm begegnen.
4.
WIE WILL DIE BIBEL VERSTANDEN WERDEN?
VON HANS-JOACHIM ECKSTEIN
Hermeneutik – einlassen und zurückkehren1
Unser ganzes Bemühen sollte darauf gerichtet sein, das Wort Gottes verstehen, interpretieren und übersetzen zu können. Die Kunst, dies zu tun, nennen wir Hermeneutik. Der Begriff hermeneuo bedeutet „übersetzen“, was wir im Deutschen so anschaulich mit übersetzen wiedergeben können – nämlich übersetzen von einem Ufer eines Flusses zu einem anderen, wie in einem Boot. Ich stehe im 21. Jahrhundert, in meinem Hier und Jetzt. Von hier gehe ich 2 000 Jahre zurück, in eine andere Zeit, in eine andere Kultur, in eine Offenbarung, die nicht von dieser Welt ist, sondern von einer anderen, der himmlischen Welt, kommt.
Das heißt, dass ich die Bibel nicht einfach aufschlagen und sagen kann: Jeder Vers ist unmittelbar für mich geschrieben und für mich unmittelbar verständlich. Es scheitert schon daran, dass nicht alle von uns Hebräisch und Griechisch können; dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben ist und das Alte Testament in Hebräisch und Aramäisch. Wir kommen gar nicht umhin, zu übersetzen.
Aber das ist nur die sprachliche Seite. Die größere Kunst ist, sich selbst zu verlassen und sich darauf einzulassen, überzusetzen zu dem Anderen, zu dem Fremden. Diese Hermeneutik des Verstehens des Anderen fordert uns schon in unserer gegenwärtigen wechselseitigen Kommunikation heraus. Denn wenn wir miteinander reden, haben wir auch die Eigenart, das zu verstehen, was wir verstehen wollen; den Anderen aus unserer Perspektive zu sehen. Wir sprechen dann nicht wirklich mit dem Anderen selbst, sondern
1 Dieses Kapitel entspricht der stark gekürzten Version des Referates „Die Schrift allein“ (sola scriptura). Die vollständige Fassung findet ihr als Audiodatei zum Herunterladen unter heko.smd.org. Der Text beginnt mit einer kurzen Einführung in die Hermeneutik.
mit dem Bild, das wir uns von ihm gemacht haben. Es ist also eine Herausforderung, das andere Ufer, den Anderen, das Gegenüber im Anders-Sein wahrzunehmen.
Dies gilt auch für die Bibel; und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel nicht nur in Losungen zerschnipselt – möglichst noch nach eigener Auswahl – zu uns nehmen. Gewiss, das gibt es: Ein Wort, das uns ins Herz trifft, als wäre es heute nur für uns geschrieben. Aber es geht zugleich und vor allem darum, die Bibel in ihrem Zusammenhang zu verstehen. Das Anderssein des Anderen wird dann besonders schwierig, wenn es sich uns zunächst als Fremdsein darstellt. Da, wo ich in den Bibeltexten etwas lese, was mir unbequem ist, da begegnet mir etwas Fremdes, das ich anpassen und einebnen will.
Ob ich dies wissenschaftlich und mit den Grundsprachen angehe oder mit einer guten Übersetzung der Bibel – es ist jeweils die Kunst, mich auf die Texte als Texte einzulassen und nach ihrem Zusammenhang zu fragen. Zugleich ist es wichtig, dass ich nicht nur eintauche, um dort zu verweilen. Hermeneutik bedeutet übersetzen, um wieder zurückzukommen. Es ist eine große Kunst, das, was ich dort am anderen Ufer Neues erfahre, in meine Gegenwart hinüberzubekommen, ohne es unterwegs zu „verwässern“. Hermeneutik ist also ein doppelter Vorgang: ein mich selbst Distanzieren auf das Gegenüber hin, das Einlassen auf das Gegenüber, das Eintauchen in das Dort – um dann zurück zu übersetzen in die Gegenwart. Das ist ein aufwändiges Geschäft. Manche kürzen das ab, um den Aufwand nicht zu groß zu machen. Sie setzen sich zwar ins Ruderboot der Gegenwart, tauchen kurz und mit Klappern der Ruder im Nebel ein, um aber gleich wieder mit der Botschaft zurückkommen: „Ich sage euch jetzt, was die Bibel meint.“ Doch in Wahrheit sagen sie eher, was sie selbst schon immer sagen wollten, und nutzen die Bibelverse nur als Steinbruch für ihre eigenen Argumente. Das kann es nicht sein.
Was ist biblisch?
Nach dieser kurzen Einführung folgt nun die Bitte um eine Differenzierung. Wenn wir kirchliche Papiere, theologische Ausführungen oder Anschreiben lesen, dann mögen wir häufig an dieser recht undifferenzierten Verwendung von Bibelstellen leiden. Deshalb schlage ich drei Unterscheidungen vor.
Biblisch 1
Im Deutschen kann „biblisch“ bedeuten, dass etwas einfach in der Bibel vorkommt und erzählt wird. Der Brudermord des Kain z. B. ist in diesem Sinne biblisch – denn er kommt in der Bibel in 1. Mose 4 vor. Manche sprechen bei schlimmen Naturkatastrophen von „biblischen Strafen“, eben weil von solchen Katastrophen in der Bibel gesprochen wurde. Damit meine ich natürlich nicht, dass wir „biblische Strafen“ gutheißen oder selbst pro-
vozieren sollten, sie werden ja zur Abschreckung beschrieben. „Biblisch 1“ ist also keine hermeneutische Kategorie. Nur weil etwas in der Bibel vorkommt, können wir es nicht zum Maßstab und zur Vorlage unseres eigenen Verhaltens machen.
Von „biblisch 1“ müssen wir „biblisch 2“ unterscheiden, die Frage: Was bedeutet diese Aussage im Zusammenhang? Dann lese ich die Zehn Gebote, wo steht: „Du sollst nicht morden“ (2Mo 20,13). Damit steht fest, dass der Mord durch Kain eben nicht biblisch ist –im Sinne von biblisch vorgegeben, gewollt und erlaubt –, sondern als ein abschreckendes Beispiel erzählt wird.
„Biblisch 2“ gibt uns die Werte vor. Um dieses Bemühen, um das ursprüngliche und eigentliche Verständnis geht es – und zwar gerade bei strittigen Fragen. Wir müssen uns die Arbeit machen, zu fragen: Wie wurde dieses Phänomen vor 2 000 Jahren in der Urchristenheit beurteilt und im Wort Gottes bezeugt? Es geht um eine historische, eine sachliche Aussage.
Aber dies allein würde bei aller Sorgfalt noch nicht genügen, denn wir wollen auch heute biblische Entscheidungen treffen. Ob wir mit dem Flugzeug, mit dem Zug oder mit dem Auto reisen – alle drei Phänomene sind „unbiblisch“ im Sinne von „biblisch 1“, denn sie kommen in der Bibel nicht vor. Deshalb kommen wir um den Schritt von „biblisch 2“ zu „biblisch 3“ nicht herum. Wir müssen das, was wir in der Bibel lesen, übersetzen in unsere Welt. Wichtig ist: „Biblisch 2“ (die Feststellung des Zusammenhangs und Schriftsinnes nach bestem Wissen, Gewissen und Verstand) und „biblisch 3“ (die aktuelle Anwendung) müssen klar auseinandergehalten werden – nicht getrennt, aber deutlich unterschieden. Dass das bei den Debatten, die wir in den letzten Jahren pflegten, nicht hinreichend passiert ist, ist hermeneutisch unverantwortlich und wirkt verwirrend und unheilvoll. Einige springen dann unvermittelt von „biblisch 1“ in die Gegenwart (in der Bibel wurde auch gemordet und Unzucht getrieben, dann können wir das heute auch für die Gemeinde freigeben). Andere wieder verfälschen bei „biblisch 2“ den Wortlaut des griechischen Grundtextes und den historischen Kontext, um vorgeblich unter „biblisch 3“ bei dem eigenen erwünschten Ergebnis zu landen, das vielleicht ganz galant und politisch korrekt in die gegenwärtige Landschaft passt.
Biblisch 3
„Biblisch 3“ ist also die Frage: Wie gehe ich heute damit um; wie wende ich das heute an? Es gibt Beispiele, bei denen das ganz einfach ist; es gibt andere, da erweist es sich als durchaus schwierig. Es sei gleich zu Beginn festgestellt, dass es nicht ein Mangel an Glaube oder Denken sein muss, wenn wir bei „biblisch 3“ verschiedene Meinungen haben. Paulus hat dazu eindrückliche Beispiele gegeben (1Kor 8–10 und Röm 14). Dort ging es um das
Fleisch, das vom Götzenopfer herrührte und auf dem Markt verkauft wurde. Paulus sagt: Ihr habt biografisch und von eurem Erkenntnisstand her verschiedene Voraussetzungen, ihr kommt zu verschiedenen Überzeugungen. Entscheidend ist, dass jeder seine eigene Überzeugung nach bestem Wissen und Gewissen und wahrhaftig begründet lebt. Lass dir von einem anderen und seinem Gewissen nicht vorschreiben, was du als „biblisch“, als Gott wohlgefällig ansiehst. – Aber: Nehmt Rücksicht aufeinander! Du kannst deine Freiheit leben; aber wenn ein anderer durch deine Freiheit persönlich zerbricht, dann ist das ein Problem. Das heißt, dass bei „biblisch 3“ durchaus verschiedene Ergebnisse herauskommen mögen – vielleicht auf Dauer, vielleicht für eine Phase. Dieses Phänomen der verschiedenen Anwendung ist also nicht an sich schon „unbiblisch“, sondern es ist vielmehr nach „biblisch 2“ ein Modell, das bereits in der Schrift selbst vorgegeben ist.
Damit sind wir aber bei dem Kern der Frage: Warum sollen wir uns auf die Bibel konzentrieren? Wie will die Bibel verstanden werden?
Nun, die Bibel ist nach unserem Bekenntnis Wort Gottes. Ist sie Wort Gottes oder bezeugt sie Wort Gottes? Ist sie Gottes Wort oder Menschenwort? Ist sie beides oder kann sie nur eines sein? Wir haben im Neuen Testament an vielen Stellen – in besonderer Klarheit und Ausführlichkeit bei Paulus – eine klare Hermeneutik. Mich fasziniert es, von der Frage: „Wie verstehe ich die Bibel?“ fortzuschreiten zu der Frage: „Wie will die Bibel verstanden werden?“ Gibt es ein Verständnis vom Wort Gottes im Wort Gottes, sodass ich aus der Bibel heraus selbst eine Hermeneutik entfalten kann?
Dazu Galater 1,11: „Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi.“ Der Anspruch des Apostels Paulus ist, dass er nicht Menschenwort verkündigt. Das Selbstverständnis der Auferstehungszeugen ist nämlich, dass Gott, der Vater, ihnen Jesus Christus offenbart hat. Das heißt, Wort Gottes im engsten und eigentlichsten Sinn ist weder eine Schrift noch ein Buch, sondern Jesus Christus selbst. In ihm, dem Sohn, hat sich der Vater selbst und letztverbindlich mitgeteilt. Dass wir das Wort Gottes heute überhaupt noch greifen können, liegt daran, dass sich der auferstandene Jesus Christus den Frauen und Männern seiner Nachfolge persönlich geoffenbart und ihnen das Evangelium weitergegeben hat. Wir brauchen die Apostel – zu denen Paulus sich selbst zählte – als letzte in der Reihe all derer, die eine Auferstehungserscheinung hatten.
Gottes Wort ist uns durch Christus im Evangelium übergeben und von den Aposteln bezeugt. Bei den Paulusbriefen haben wir nun – und das fasziniert mich besonders – einen Autor, der zugleich Apostel und Verfasser neutestamentlicher Schriften ist. Lukas z. B. beansprucht nicht, selbst zu dieser ersten Generation der Auferstehungszeugen zu gehören; er gibt sorgfältig weiter, was er von Anfang an genau erkundet hat (Lk 1,1–4). Insofern haben wir im Neuen Testament selbst bereits eine Abstufung der Überlieferungsgenerationen.
Dies lässt sich vielleicht durch das anschauliche Bild eines römischen Brunnens verdeutlichen. Ganz oben – noch oberhalb der ersten Schale – sprudelt das Wasser unmittelbar aus der Quelle bzw. der Zuleitung. Dies entspricht dem Wort Gottes in Person, das Jesus Christus als der eigentliche Ursprung und Inhalt des Evangeliums ist.
Die allererste Schale entspricht dann dem Evangelium als dem Wort Gottes, das der Auferstandene seinen Aposteln bei seinen Erscheinungen gegeben hat, wie es Paulus in Galater 1,11–16 ganz ausdrücklich hervorhebt.
Die zweite Schale, in die sich das Wasser von oben unmittelbar ergießt, ist uns mit dem Zeugnis der Apostel gegeben und gewissenhaft überliefert. Schon mit dem Neuen Testament haben wir – bildlich gesprochen als dritte Schale – die nächste Stufe der Verkündigung und Überlieferung der Apostelschüler wie z. B. auch Timotheus. Nach 2. Timotheus 2,2 soll er das von Paulus empfangene Evangelium selbst wiederum anderen weitergeben, die ihrerseits in der Lage sind, andere zu lehren. Damit kommen bereits weitere Schalen über die Zeit des Neuen Testaments hinaus in den Blick, in denen das Evangelium empfangen, treu bewahrt und gewissenhaft weitergegeben wird.
Was meinen wir mit diesem Bild des römischen Brunnens, der zugleich den beständigen Fluss wie auch die Abstufung symbolisiert? Ein römischer Brunnen hat darin seine geheimnisvolle Faszination, dass er ganz oben – und nur dort – seine Quelle hat, aus der das Wasser sprudelt und sich in Stufen nach unten ergießt. Diese Quelle ist nach dem Selbstverständnis des Neuen Testaments das Wort Gottes in Person, Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes, der gegenwärtig zur Rechten seines Vaters sitzt und im Heiligen Geist gegenwärtig und wirksam ist. Er hat das Evangelium seinen Jüngern und den wenigen anderen Auferstehungszeugen wie Paulus unmittelbar erschlossen und übergeben. Denn nach Paulus und den Evangelien hat sich der Auferstandene ihnen selbst gezeigt. Er hat sie belehrt über das Wesen und den Willen seines Vaters, über seine eigene Person und seinen Weg bis hin zu Kreuz und Auferstehung, über seine Vollmacht und seinen Auftrag an die Jünger bis zur Wiederkunft.
Somit sind wir heute angewiesen auf das Zeugnis der Apostel, wie es im Neuen Testament erhalten ist. Warum brauchen wir aber die Unterscheidung zwischen der zweiten Schale – d. h. der Ebene des unmittelbar von Christus gegebenen Evangeliums –und der dritten Schale – d. h. des Zeugnisses der Apostel? In Galater 2,11ff. erfahren wir von einem Fall, den man als hermeneutischen „Worst Case“ bezeichnen könnte, als einen „schlimmsten anzunehmenden Unfall“. Bei dem hier geschilderten Konflikt kommt es im Zusammenhang der Abendmahlsgemeinschaft zu der Situation, dass mit Petrus und Paulus zwei Apostel konträre Entscheidungen treffen und im Blick auf die „Wahrheit des Evangeliums“ das Gegenteil verkündigen. Was gilt jetzt? Paulus – obwohl Apostel –verpflichtet sich selbst im ersten Kapitel des Galaterbriefs und sagt: „Ich muss mich auch und gerade als Apostel streng an die Wahrheit des Evangeliums halten; und wenn ich abweichend von dem Evangelium verkündige, das mir Jesus als Auferstandener gegeben
hat, dann wollte ich verflucht sein.“ Dieser „Eventualfluch“ in Galater 1,6ff. wirkt auf uns zunächst verstörend, er bringt aber grundlegend zum Ausdruck, dass Paulus nicht sich selbst verkündigt und nicht selbst Maßstab ist, sondern allein das ihm offenbarte Evangelium. Nicht er ist die Quelle, das ist Jesus Christus; und nicht er ist Maßstab, sondern auch er ist an der vorgegebenen Wahrheit des Evangeliums zu messen und davon abhängig. Die besondere Autorität als Apostel liegt ausschließlich darin, dass er das Evangelium, das Christus ihm anvertraut hat, nach bestem Wissen und Gewissen so weitergibt, wie Christus es ihm vorgegeben hat.
Damit haben wir eine klare Differenzierung und Hierarchisierung bei dem Gebrauch der Bezeichnung „Wort Gottes“. Vorgeordnet, in letzter Verbindlichkeit und an höchster Stelle gilt erstens als Wort Gottes Jesus Christus in Person.
Zweitens ist Wort Gottes das von Christus offenbarte vorgegebene Evangelium, das wir ohne das Zeugnis der Apostel nicht hätten, weil wir nicht bei den Auferstehungserscheinungen dabei waren. So gilt drittens im Neuen Testament als Wort Gottes das Zeugnis des Evangeliums Jesu Christi durch die Apostel – und in Abhängigkeit von ihnen schließlich durch die Schüler der Apostel.
Wenn jemand den „römischen Brunnen“ versteht, kann er mutig Theologie studieren und ist für manche Glaubenskrise gewappnet. Denn er glaubt nicht an sein eigenes Schriftverständnis und nicht an Menschen oder menschliche Zeugnisse, sondern an den lebendigen Sohn Gottes, Jesus Christus. Dieser offenbart sich durch seinen Geist auch heute noch im Evangelium durch das Zeugnis der Apostel in den Schriften des Neuen Testaments. Es mag sein, dass in meiner Gemeinde zu einem bestimmten Punkt sechs Theologen sieben Meinungen vertreten. Das muss mich aber nicht anfechten. Es mag sein, dass ich im Neuen Testament – und vor allem im Blick auf das Alte Testament – Aussagen finde, die ich nach meinem Stand der Erkenntnis nicht einordnen und mit meinem Verständnis von Evangelium zusammenbringen kann. Dann muss ich nicht sagen: „Der eine denkt so, der andere denkt so“, sondern dann bin ich von den Aposteln eingeladen und vom Evangelium gefordert, zu prüfen, nachzufragen und um die Wahrheit des Evangeliums zu ringen.
Denn wir sind einbezogen. Wir sind – gewissermaßen als unterste Schale des römischen Brunnens – in den Überlieferungsprozess einbezogen. Wir sind zur Podiumsdiskussion der neutestamentlichen Zeugen eingeladen. Deshalb ermutige ich Theologiestudierende so gern, sich einzuschalten in die Diskussion der Zeugen des Wortes Gottes; nicht locker zu lassen, sondern zu sagen: „Jetzt will ich es aber genau wissen! Was ist das Evangelium? Was ist die eine Wahrheit des Evangeliums in der Vielstimmigkeit dieses Zeugnisses?“ Wir sind gewürdigt und in Verkündigung, Lehre und Seelsorge herausgefordert, theologisch verbindliche Urteile zu fällen. Aber nicht, indem wir beliebig sagen: „Das ist mir sympathisch, das hat mir schon immer gefallen, also spreche ich dir das mal so zu.“ So
kämen wir nur zu willkürlichen Urteilen unserer eigenen Vorurteile. Inhalt, Quelle und Maßstab ist jeweils nichts anderes und nicht weniger als Jesus Christus selbst, der uns durch seinen Geist in dem biblischen Zeugnis seines Evangeliums gegenwärtig ist.
Jetzt aber sind wir bei der eigentlich spannenden Frage: Ist das Wort – gemäß dem Modell des römischen Brunnens – nun Wort Gottes oder ist es Menschenwort? Das Faszinierende ist: Dies erweist sich als ein falscher Gegensatz. Wort Gottes im eigentlichsten Sinne ist Jesus Christus in Person. Wenn dieser Christus deine Mitte ist, dann kann dich keine Hermeneutik oder Theologie mehr aus den Angeln heben, denn dann hast du das tragende Wort Gottes.
Warum ist es so wichtig, dass wir das in der Schrift bezeugte Evangelium von Jesus Christus als Wort Gottes erkennen? Nun, wir haben nicht nur eine Abstufung von oben nach unten – im Sinne von „immer weniger Autorität, immer mehr Angewiesensein auf Kritik“ –, sondern es gilt auch umgekehrt: Wenn niemand aus der untersten Schale des Brunnens in Form von theologischen Verfälschungen und Irrlehren „giftiges Wasser“ in eine obere Schale des Brunnens spritzt, dann wirkt der Heilige Geist auch in unserer Verkündigung, Lehre und Seelsorge.
Das Wort Gottes ist Dynamis und es hat Kraft. Es ist deshalb so wichtig, dass wir wirklich das Wort Gottes verkündigen und nicht unsere Lieblingsmeinung. Überall dort, wo es erklingt, hat es in sich selbst die Kraft, den Glauben zu wirken. Es sind nicht die Menschen, die sich für Gott entscheiden – es ist Gott, der sich für die Menschen entscheidet. Es sind nicht unsere Worte, die Menschen überzeugen, es ist die Kraft des Wortes Gottes und des Evangeliums. Wenn wir nichts anderes tun wollen, als Christus allein, allein seine Gnade, allein die Schrift und allein den Glauben den Menschen zuzusprechen, dann erleben wir heute das, was geschah, als Christus den Auferstehungszeugen begegnete. Gott will auch heute durch uns sprechen. Und deshalb gilt nicht nur: Das Neue Testament ist Gottes Wort im menschlichen Zeugnis – sondern es gilt zugleich: Euer menschliches Wort soll als Gottes Wort wirken.2
2 Empfehlung zum Weiterlesen: Hans-Joachim Eckstein: Wie will die Bibel verstanden werden? SCM Hänssler, Holzgerlingen 2016, S. 133–160.
WARUM DIE BIBEL IN MEIN LEBEN HINEINSPRECHEN DARF
VON GERNOT SPIES
Die Bibel ist von Gott eingegeben und völlig vertrauenswürdig. Sie ist höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und Lebenswandels“, so heißt es in den Richtlinien der SMD . 1 Wie lassen sich diese Sätze begründen? Welche Konsequenzen erwachsen daraus? Wie lesen wir überhaupt die Bibel? Und wie kommen wir dann zu überzeugenden und eindeutigen ethischen Entscheidungen? Die SMD war und ist immer Bibelbewegung gewesen. Mein Vortrag knüpft an diesem Erbe an und versucht Orientierung zu geben.2
Die Frage nach der Schrift ist ins Kreuzfeuer geraten. Zwei Impulstexte aus der jüngeren Vergangenheit mögen das verdeutlichen:
Die ganze Bibel ist Gottes Wort – durch sie spricht Gott zu uns; er zeigt uns, wer er ist und was er will. Wir stehen ein für das Vertrauen in die Heilige Schrift. Gottes Wort und menschliche Worte sind in ihr untrennbar verbunden. Einheit und Vielfalt ihres Zeugnisses finden ihre Mitte in Jesus Christus. Wir stehen auf für die Wahrheit des Wortes Gottes und gegen die Kritik an der Bibel als Autorität für die Lehre der Kirche und das Leben der Christen. Die Bibel ist immer aktueller als der jeweilige Zeitgeist.3
1 Richtlinie 3k, Richtlinien der SMD , letzte Fassung von 2016.
2 Dieses Kapitel geht zurück auf einen Vortrag vor der Delegiertenversammlung der Hochschul-SMD im Februar 2015 und wurde inhaltlich ergänzt und erweitert. Der Vortragsstil wurde an vielen Stellen beibehalten, inklusive einiger Impulstexte und Fragen zum Weiterdenken.
3 Aus: Michael Diener/Steffen Kern (Hrsg.): Zeit zum Aufstehen – Ein Impuls für die Zukunft der Kirche. SCM Hänssler, Holzgerlingen 2014, These 4.
Eine ganz anders gelagerte Positionierung hört sich so an:
Das sola scriptura lässt sich heute nicht mehr in der gleichen Weise verstehen wie zur Reformationszeit. Anders als die Reformatoren ist man sich heute dessen bewusst, dass das Entstehen der einzelnen biblischen Texte und des biblischen Kanons selber ein Traditionsvorgang ist. Die alte Entgegensetzung von „die Schrift allein“ und „Schrift und Tradition“, die noch die Reformation und Gegenreformation bestimmte, funktioniert heute nicht mehr so wie im sechzehnten Jahrhundert. Aber dennoch gilt: „Nach evangelischer Auffassung müssen sich die Traditionen immer am Ursprungszeugnis der Schrift und ihrer Mitte orientieren, sie müssen von hier aus kritisch bewertet und immer neu angeeignet werden.“
Seit dem siebzehnten Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch-kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformatoren als „Wort Gottes“ verstanden werden. Die Reformatoren waren ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Angesichts von unterschiedlichen Versionen eines Textabschnitts oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich diese Vorstellung so nicht mehr halten. Damit aber ergibt sich die Frage, ob, wie und warum sola scriptura auch heute gelten kann.4
Was ist an diesen Texten berechtigt? Was ist fragwürdig? Welche Folgen ergeben sich daraus für den Umgang mit der Schrift? Wie würde ich die Frage nach der Autorität der Schrift beantworten?
Wenn ich über die Bibel und unser Schriftverständnis nachdenke, dann tue ich das unter dem Blickwinkel der Freude. Gott hat geredet – und er redet heute. Er tut das in, mit und unter dem überlieferten Wort der Bibel. Wir glauben an einen Gott, der redet: schöpferisch und kreativ; rettend und überraschend; zurechtbringend und leitend. Die Bibel verdankt sich diesem Reden Gottes. Sie ist insgesamt ein Bericht über das Reden Gottes und zugleich Quelle und Grundlage des Redens Gottes heute.
Nur durch die Bibel
▶ erfahren wir von diesem Gott als Schöpfer und Retter der Welt;
4 Aus: Rechtfertigung und Freiheit – 500 Jahre Reformation. EKD 2017, S. 83f.
▶ erfahren wir von Jesus Christus, dem Sohn Gottes und dem Heil;
▶ erfahren wir von dem, was Jesus schenkt, und dem Leben, das er verheißt;
▶ erfahren wir von dem Zugang zu Gott dem Vater;
▶ erfahren wir von der Wahrheit und Wirklichkeit des Evangeliums.
Damit kommt diesem Buch eine besondere und einzigartige Bedeutung zu. Darin gründet das sola scriptura (allein die Schrift) der Reformatoren. Die Frage, wie wir zur Bibel stehen, wie wir die Bibel verstehen und wie wir sie auslegen, ist damit eine Zentralfrage von Theologie und Glaube.
Das Volk Israel konnte das Reden Gottes feiern. Da ist z. B. der Psalm 119: Ein Loblied auf das Wort Gottes, genauer das Reden Gottes in seinen Weisungen, der Tora. Kämen wir auf die Idee, ein Loblied auf das Wort Gottes zu singen? Ja mehr noch, auf seine Gebote?! „Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht“ (Ps 119,162). Israel konnte das tun, weil es wusste, dass Gottes Weisung immer gelingendes Leben zum Ziel hat. Sein Wort schafft Leben. Wir glauben an einen Gott, der redet. Dessen Wort Leben schafft. Von Israel dürfen wir uns mit dem Zutrauen anstecken lassen, dass das Hören auf diesen Gott Leben entfaltet.
Wenn wir uns so auf die Bibel einlassen, dann provoziert das Fragen: Was bestimmt unser Verhältnis zur Bibel? Freude an einem Gott, der redet, oder Probleme mit einer Schrift, die uns an manchen Stellen Mühe macht? Persönlicher gefragt: Hast du die Bibel lieb? Bist du in der Bibel zu Hause? Lässt du dich von ihr herausfordern? Was setzt du ein, um sie dir „zu eigen“ zu machen?
Es ist wichtig, dass wir nicht aus der Distanz über die Bibel „philosophieren“, sondern in der Beschäftigung mit ihr und dem Schöpfen aus ihr reden und leben lernen. Das Erste, was es festzuhalten gilt: Es liegt ein Glanz über der Heiligen Schrift. Der lebendige Gott gibt sich in ihr, seinem Wort, zu erkennen.
7.2 Begründung – Was der Bibel ihre Autorität verleiht
Die Inspiration der Schrift
Wer sich auf die Suche nach einer Belegstelle begibt, mit der die Autorität der Bibel begründet werden könnte, wird enttäuscht. Es gibt nicht die eine Stelle, auf die wir uns beziehen könnten. Ein anderer Weg ist uns gewiesen.
Vor allem anderen gilt: Wir empfangen die Bibel aus den Händen Jesu. Seine Bibel war unser AT oder jedenfalls weite Teile daraus. Damit hat er gelebt, daraus zitiert. Im Gespräch mit der Schrift hat er seinen Weg gedeutet und die Gestaltung des Lebens mit Gott begründet. So zum Beispiel
▶ in der Versuchungsgeschichte, wenn er dem Widersacher entgegenhält: „es steht geschrieben“ (Mt 4,4 u. ö.);
▶ in den Leidensankündigungen, wenn er betont, es „muss“ geschehen, „es muss erfüllt werden“ – weil es in der Schrift steht (vgl. z. B. Mk 8,27ff.);
▶ in den Begegnungen nach seiner Auferstehung, wenn er die Schrift auslegt: „Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war“ (Emmausgeschichte, Lk 24,26f.). „Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden: So steht’s geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage …“ (im Jüngerkreis in Lk 24,44).
Aus den Händen Jesu – das ist das erste, was wir zur Autorität der Bibel sagen können. Die Autorität des Neuen Testaments ist davon abgeleitet: Die Bibel bezeugt Jesus – vorausschauend im Alten Testament und rückblickend im Neuen Testament. Jesus hat uns aufgeschlossen, wer Gott ist und wie er ist, als Schöpfer und Retter, als Erhalter und Richter, als der, der unser Leben beschenkt und beauftragt. Nur durch Jesus wissen wir von Gott und nur durch das NT wird uns Jesus nahegebracht. Jesus verleiht der Bibel damit letztlich ihre Einzigartigkeit und Autorität.
Unter diesem Vorzeichen können nun doch noch einige Bibelstellen herangezogen werden. Sie bestätigen diese Perspektive:
▶ 1Joh 1,1–3: „Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben … vom Wort des Lebens … und das Leben ist erschienen und wir … bezeugen und verkündigen euch das Leben …“ Das Neue Testament beansprucht im Gefolge der Apostel (Gesandte, bevollmächtigte Beauftragte), Christus selbst zu Gehör zu bringen. Das Zeugnis der Apostel zielt immer auf Christus.
▶ 2Tim 3,16: „Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit …“ Von Gott eingegeben (wörtlich theo-pneustie, Gott-Einhauchung). Hier wird Gott als Urheber und Autor bezeugt, ohne den Vorgang näher zu beschreiben. Hier wird ein Sachverhalt bezeugt, aber nicht erklärt. Es wird also keine geschlossene Inspirationstheorie vertreten. Darum ist der neutrale, eher technische Begriff der Inspiration nicht so angemessen, wie der personale der theo-pneustie – der Gott-Einhauchung. Wir haben es immer mit Gott selbst zu tun.
▶ 2Petr 1,21. Dort heißt es über das prophetische Wort der Schrift – unser Altes Testament: „Denn es ist noch nie eine Weisheit aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet.“ Es gibt keine vergleichbare Aussage über die quantitative Gesamtheit
aller biblischen Bücher oder über das NT insgesamt. Auch Offb 22,18f. gilt streng genommen nur für das Buch der Offenbarung. Aber das Zeugnis des Neuen Testaments insgesamt bestätigt diese Grundhaltung gegenüber der Gesamtheit der Schrift: Gott hat es gefallen, dieses Buch entstehen zu lassen. Darin gibt er sich zu erkennen.
Durch dieses Wort zeigt er den Weg des Heils in Jesus Christus.
Die Bibel ist also durchweg bestimmt von einem Ineinander von Wort Gottes und Geist Gottes. Dieses Ineinandergreifen ermöglichte es Menschen erst, vollmächtig und autoritativ zu reden und zu schreiben.
Die Bibel hat ein zentrales Thema, die „Mitte der Schrift“ – wie Luther es ausgedrückt hat –: Jesus Christus und seine Erlösungstat. Im Dienst dieser zentralen Botschaft stehen die Bücher der Bibel – ankündigend im Alten Testament, verkündigend in den Evangelien und entfaltend in den Briefen des Neuen Testaments.
In diesem Sinne können wir dann angemessen auch von Inspiration der Heiligen Schrift sprechen. Eine kurze Definition:
„Als Inspiration der Heiligen Schrift bezeichnen wir denjenigen geschichtlichen Gesamtvorgang, durch den der Heilige Geist bestimmte Schriften zu Gottes Wort an alle Menschen gemacht hat.“5
Eine ausführlichere und damit vertiefende Definition findet man bei Helmut Burkhard:
Inspiration der Bibel heißt: „Gott hat die Herzen von ihm berufener und bevollmächtigter Menschen in ihrer Autorschaft auf das hingelenkt, worauf es ihm im Verfolg seines Heilsratschlusses ankam. Er befreite dabei ihren Willen von seiner sündigen Eigenmächtigkeit und machte ihren Verstand hellsichtig, nicht nur Gottes unmittelbares Offenbarungswort, sondern auch sonst das Offenbarwerden seiner Wahrheit in Schöpfung und Geschichte wahrzunehmen und angemessen zum Ausdruck zu bringen.“6
Der Kanon der Schrift
Bei den 66 Büchern der Bibel sprechen wir auch von einem Kanon verbindlicher Schriften. Kanon heißt „Richtschnur, Maßstab, festgesetzte Ordnung“. Wie kam es zu dieser Sammlung? Was kennzeichnet den biblischen Kanon und was bedeutet das für die Autorität der Schrift?
5 Gerhard Maier: Heiliger Geist und Schriftauslegung. R. Brockhaus, Wuppertal 1983, S. 13.
6 Die Inspiration der Bibel. In: Porta Studie „Gotteswort im Menschenwort“, S. 67.
Auch hier gibt es nicht die eine Schlüsselantwort. Bei der Bildung des biblischen Kanons handelt es sich um ein dynamisches Geschehen, das sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte. Um 200 n. Chr. gab es bereits weitgehend Übereinstimmung in der Zusammenstellung verbindlicher Schriften. Aber erst im 4. Jahrhundert n. Chr. war die Bildung des Kanons zum Abschluss gekommen.
Vor allem vier Kriterien waren bei der Auswahl und Anerkennung biblischer Schriften maßgebend:
▶ Christozentrik – Leitend war die Frage, ob Jesus im Mittelpunkt steht. Alle Schriften sind auf ihn hin bzw. von ihm her zu verstehen (Kriterium der heilsgeschichtlichen Mitte).
▶ Apostolizität – Entscheidend war die Rückfrage nach der Augenzeugenschaft und Autorschaft. Die Zuverlässigkeit der Überlieferung und ihre Unmittelbarkeit war wichtiges Auswahlkriterium (Kriterium der Originalität, Otto Weber).7
▶ Katholizität (Allgemeingültigkeit) – Aufgenommen wurden Schriften, die nicht bloße Privatschreiben, sondern für die Allgemeinheit der Kirche bestimmt waren (Kriterium der Allgemeingültigkeit).
▶ Autopistie (Selbstwirksamkeit) – Hinzu trat die Bewährung in den Gemeinden. Aufgenommen wurden Schriften, von denen eine in sich selbst gewirkte Anerkennung ausging (Kriterium der Wirkung).
Keines dieser Kriterien kann für sich alleine stehen. Sie ergänzen sich und bedingen einander. Nur im Zusammenspiel waren diese Kriterien eine Hilfe zum Annehmen und Anerkennen des Kanons.
Die Kanonbildung entspricht damit der Offenbarung Gottes durch Jesus Christus in Zeit und Raum. In menschlicher Geschichte und Tradition gibt Gott sich zu erkennen: verbindend und verbindlich, einmalig und einzigartig. Auf Jesus Christus als dem einmalig und geschichtlich abgeschlossenen, geschehenen Wort Gottes folgt das einmalige und geschichtlich abgeschlossene Wort im schriftlich bezeugten Kanon der Bibel. Eine Ergänzung oder gar Einschränkung des Kanons verbietet sich daher.
Das Bekenntnis zur Inspiration der Schrift schließt damit das Bekenntnis zum Wirken Gottes beim Zustandekommen dieses Kanons ein. Gerhard Maier dazu: „Ehrlicherweise müssen wir … sagen, daß ohne die Annahme einer göttlichen Providenz bei der Kanonbildung nicht auszukommen ist.“ Nicht die Kirche, Gott selbst ist ihr Urheber.8
7 Otto Weber: Grundlagen der Dogmatik, Band 1. Neukirchener Verlagsgesellschaft, NeukirchenVluyn 72013, S. 285.
8 Gerhard Maier, a. a. O., S. 13.
Bei John Stott habe ich dazu ein interessantes Zitat aus der anglikanischen Kirche gefunden: „Die Kirche steht nicht ‚über‘ der Heiligen Schrift, sondern ‚unter‘ ihr in dem Sinne, dass der Prozess der Kanonisierung nicht den Büchern der Schrift selbst Autorität übertrug, sondern die Kirche erkannte darin die Tatsache an, dass sie Autorität besitzen.“9
Die Bibel als unverzichtbarer Maßstab – einige Schlussfolgerungen
Darum ist die Heilige Schrift für Christen „norma normans“ – die normierende Norm, der Maßstab, an dem wir uns zu orientieren haben.
In der Konkordienformel, einer der lutherischen Bekenntnisschriften, wird das im Eingangsvotum so beschrieben: „Wir glauben, lehren und bekennen, daß die einige Regel und Richtschnur [‚unicam regulam et normam‘], nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurteilet werden sollen, seind allein die prophetischen und apostolischen Schriften Alten und Neuen Testaments …“10
Autorität der Schrift heißt dann:
▶ Die Heilige Schrift verfügt über uns, nicht wir über sie.
▶ Sie ist höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens – denn sie allein weist uns den Weg zu Christus, zur Erlösung und zum Glauben.
▶ Sie ist höchste Autorität des Lebenswandels, weil uns in ihr der begegnet, der uns das Leben gab, es erhält und erlöst, und uns letztlich zum gelingenden Leben führen will.
Autorität hat die Bibel allein durch den, der durch sie spricht. Es handelt sich also um ein dynamisches Geschehen und ein Zusammenspiel von in der Heilsgeschichte geschehenem, in der Schrift geschriebenem und in vollmächtiger Verkündigung geschehendem Wort Gottes.
Wenn wir von der Autorität der Schrift sprechen, handelt es sich damit letztlich um einen Zirkelschluss: „Die Bibel führt uns zum Glauben an Jesus Christus, und der Glaube an Jesus Christus führt wiederum zu tieferer Erkenntnis der Wahrheit Gottes in der Bibel.“11 Darum sprechen die SMD -Richtlinien auch sehr angemessen von der Vertrauenswürdigkeit der Schrift. Es geht um eine personale Dimension. Da, wo ich mich auf
9 Aus einem Begleitdokument der Lambeth Conference 1958. Zitiert nach: John Stott: Christus, die Bibel und wir – Autorität der Bibel, Grundsätze der Bibelauslegung, christliches Denken, Einfluss in der Gesellschaft. SDG-Verlag, Waldenburg 2011, S. 27.
10 Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 81979, S. 767.
11 Gnadauer Erklärung: „Unsere Stellung zur Heiligen Schrift“, Februar 1981. In: Kurt Heimbucher/ Theo Schneider (Hrsg.): Gnadauer Dokumente. Brunnen Verlag/Gnadauer Verlag, Gießen/Basel/ Dillenburg 1988, S. 160.
diese Botschaft einlasse, vertraue ich darauf, dass Gott in seiner Kraft die Zuverlässigkeit und Tragfähigkeit seiner Worte bewährt.
Das liegt ganz auf der Linie Jesu, der so zu sich eingeladen hat: „Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er innewerden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selber rede“ (Joh 7,16f).
Die Frage nach der Autorität der Schrift ist also eine größere Frage, als dass sie mit der einen Stelle zu beantworten wäre. Wir müssen die Bibel im Zusammenhang lesen und verstehen.
Im Übrigen: Die eine Stelle würde in aller Regel auch nicht befriedigen; Kritiker und Zweifler würden dann rasch diese Stelle, ihren Kontext, ihre Aussagekraft, ihre Zuverlässigkeit und Zuständigkeit infrage stellen. Wir müssen uns schon um einen gesamtbiblischen Bogen bemühen.
Hermeneutik ist die Lehre vom Verstehen und Erklären eines Textes. Wenn wir die Bibel lesen, ist immer Übersetzung notwendig. Jede Übersetzung ist letztlich eine Deutung. Ohne Interpretation geht es nicht. Das hat mit dem Wesen von Offenbarung zu tun. Um diese Fragen geht es jetzt.
Das Reden Gottes geht nie über die Köpfe hinweg, sondern geschieht immer in Zeit und Geschichte hinein. Gott begibt sich gewissermaßen auf Augenhöhe mit denen, zu denen er spricht. Gott lässt es sich etwas kosten, verständlich zu werden. Er müht sich herab auf die Stufe des Menschen, um gehört und verstanden zu werden. Darum ist der Raum, die Zeit, die Sprache und die prägende Umgebung für das Verstehen wichtig.
Im Philipper-Hymnus (Phil 2,7f.) heißt es von Jesus Christus: Er „entäußerte sich selbst [keno-o – entleeren] und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst … [tapeivosein – klein machen] und ward gehorsam bis zum Tode …“
Theologen nennen das „Kondeszendenz“, die Erniedrigung Gottes. Von con-descere –gnädige Herablassung. Gott erniedrigt sich, macht sich klein, um sich verständlich zu machen.
So kann man auch sagen, dass das Reden Gottes in der Schrift ein Teil dieser Entäußerung ist. Auch die Schrift trägt Züge der Knechtsgestalt. Gott begibt sich hinein in unsere Wirklichkeit, um gehört und geglaubt zu werden.
Die Dogmatik hat in der Lehre von Christus die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre formuliert. Im Anschluss an das Neue Testament muss man das scheinbar Widersprüchliche bekennen: In Jesus begegnet uns Gott – als wahrer Mensch und Gott zugleich. Er nahm unser Menschsein an und war doch Gott. Nur so konnte er Versöhnung schaffen. Er, der unser Leben geteilt hat, konnte unsere Schuld auf sich nehmen und vergeben, weil er zugleich als der Sohn Gottes gehandelt hat. Das lässt sich letztlich nur spannungsvoll beschreiben: wahrer Mensch und wahrer Gott, zwei Mal einhundert Prozent.
Die Zwei-Naturen-Lehre lässt sich auch auf die Schrift übertragen. Wir haben nie das eine ohne das andere. Beides gehört untrennbar zusammen: Menschenwort und Gotteswort. Das lässt sich nur spannungsvoll beschreiben. Auch das ist Teil der Erniedrigung, der Knechtsgestalt Gottes. Jeder Versuch, diese Spannung aufzulösen, führt in Schwierigkeiten:
▶ Entweder müssen wir die Göttlichkeit der Schrift „retten“, indem wir jedes Hinterfragen verbieten, den Verstand ausschalten, mühsame Beweisketten suchen, wenn wir uns z. B. an manchen Spannungen reiben.
▶ Oder aber: Wir müssen die Schrift als rein historische, religionsgeschichtliche Urkunde sehen – und haben dann das Problem, wie wir ihre Bedeutung gegen historische und philosophische Zweifel und Einwände „retten“ können.
In der Folge der Aufklärungszeit hat man versucht, hinter der brüchigen Schale historischer Begrenzungen die eigentliche, wahre, beständige Aussage zu suchen. Hinter der historischen Fassade gelte es die übergeschichtliche Wahrheit zu finden. Gotteswort – ja, aber jenseits bzw. hinter dem geschriebenen Wort. Die Bibel ist nicht Gotteswort, sondern enthält es allenfalls. Das müsse gewissermaßen herausgefiltert werden. Nicht Gotteswort und Menschenwort zugleich, sondern Gotteswort im Menschenwort. Es gehe um den „Kanon im Kanon“ (Ernst Käsemann). Dem Ausleger kommt damit eine unangemessene, wertende Rolle zu. Er hat die Aufgabe und Last, zu entscheiden, was zu gelten hat und was nicht.
Dem muss widersprochen werden: eine Trennung von Gottes- und Menschenwort in der Bibel ist nicht angemessen. Zu dem „sola scriptura“ (allein die Schrift) muss das „tota scriptura“ (die ganze Schrift) hinzutreten. Denn eine Trennung der Schrift in ihre gewissermaßen menschlichen und göttlichen Bestandteile widerspricht dem Wesen von Offenbarung. Sie unterwirft die Offenbarung unserem rationalistischen Zugriff. Aber nie verfügen wir über die Offenbarung, immer ergeht sie an uns – und verfügt damit auch über den Menschen.
Das macht gerade das Wesen von Offenbarung aus: Gott kommt uns nah, redet auf „Augenhöhe“ und setzt sich zugleich möglichen Missverständnissen, „Zweideutigkeiten“ und Fehlinterpretationen aus. Das lässt sich z. B. an den Jesusbegegnung im NT erkennen:
DR. HANS-JOACHIM ECKSTEIN ist Professor für Neues Testament und lehrte von 2001 bis 2016 an der Universität Tübingen. Er verbindet den Glauben mit dem Alltag, die Theologie mit den Menschen, die Universität mit der Gemeinde. Hans-Joachim Eckstein ist Theologe, gefragter Referent für Großveranstaltungen, Vorträge und Bibelarbeiten sowie Musiker und Poet.
DR. TIMOTHY J. GEDDERT , geboren in Kanada, ist Professor für Neues Testament am Fresno Pacific Biblical Seminary in Kalifornien/USA . Vor allem aufgrund der deutschen Herkunft seiner Frau lebten Gedderts immer wieder auch in Deutschland. Er war selbst Gemeindegründer und Pastor und wird in viele Länder als Referent zu Tagungen, Seminaren und in Gemeinden eingeladen. Im deutschsprachigen Raum ist Timothy J. Geddert u. a. durch seine Bücher bekannt, z. B. Das sogenannte Alte Testament – Warum wir nicht darauf verzichten können und Das immer wieder Neue Testament.
MARKUS HEIDE ist evangelischer Pfarrer und Leiter des Christus-Treff in Marburg. Nach seinem Theologiestudium war er Reisesekretär der Hochschul-SMD . Anschließend hat er sein Vikariat in Mecklenburg-Vorpommern und erste Berufsjahre als Pfarrer in der Gehörlosenseelsorge und als persönlicher Referent des Bischofs ins Greifwald absolviert. Von 2011 bis 2021 war Markus Heide Leiter der Hochschul-SMD .
SABINE KALTHOFF arbeitet als Secretary for Spiritual Formation im weltweiten Dienst der International Fellowship of Evangelical Students (IFES ). Außerdem ist sie Hochschulpastorin an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg. Von 2011 bis 2021 war sie Secretary for Scripture Engagement und half Hauptamtlichen und Studierenden in IFESBewegungen weltweit, einen lebendigen Zugang zur Bibel zu finden und anderen zu vermitteln. Zuvor war sie 14 Jahre für die Hochschul-SMD tätig, darunter zehn Jahre als Leiterin.
FABIAN MEDERACKE ist evangelischer Pfarrer in Wittenberg. Nach seinem Theologiestudium war er zunächst in der Jugendarbeit des CVJM München tätig. Anschließend war
er Regionalreferent der Hochschul-SMD in Mitteldeutschland. In dieser Zeit hat er die Bibellesezeichen der IFES für den deutschen Kontext übersetzt, angepasst und weiterentwickelt sowie eine Webseite für christliche Apologetik entwickelt: begruendet-glauben.org.
RAINER SCHÖBERLEIN ist Referent der Akademiker-SMD mit Schwerpunkt junge Akademiker. Der Maschinenbauingenieur, Theologe und Coach begleitet Menschen bei der Berufsorientierung und der Berufungsklärung. Er war von 2004 bis 2011 Reisesekretär der Hochschul-SMD .
GERNOT SPIES ist Generalsekretär der SMD und regelmäßig Referent und Bibelausleger auf Konferenzen, Tagungen und Freizeiten. Nach seinem Theologiestudium führten ihn Stationen als Reisesekretär der Hochschularbeit der SMD , Vikar und evangelischer Pfarrer quer durch die Bundesrepublik.
Die SMD ist ein Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und akademischer Berufswelt. Wir haben Kontakt zu rund 600 Schülerbibelkreisen, sind mit Hochschulgruppen an mehr als 80 Universitäten vertreten und bieten etwa 20 Fachgruppen und Netzwerke für Akademiker an. Die SMD wurde 1949 als „Studentenmission in Deutschland“ gegründet und ist heute ein freies Werk im Raum der Kirche mit Angeboten für Menschen aller Altersgruppen. Wir fördern einen lebendigen christlichen Glauben, der sich nicht nur auf den Sonntag beschränkt, sondern den ganzen Alltag von Christen durchdringt. Dabei richten wir uns besonders an heutige und zukünftige Verantwortungsträger: Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Akademikerinnen und Akademiker. Auf diese Weise leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Zukunft von Kirche und Gesellschaft in unserem Land.
Wir arbeiten überkonfessionell auf Basis der Evangelischen Allianz, eine gute Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen und Gemeinden vor Ort ist uns wichtig. Die SMD ist Mitglied in der Diakonie Deutschland der EKD und in der International Fellowship of Evangelical Students (IFES ), wo wir mit über 160 Studierendenbewegungen weltweit verbunden sind.
www.smd.org
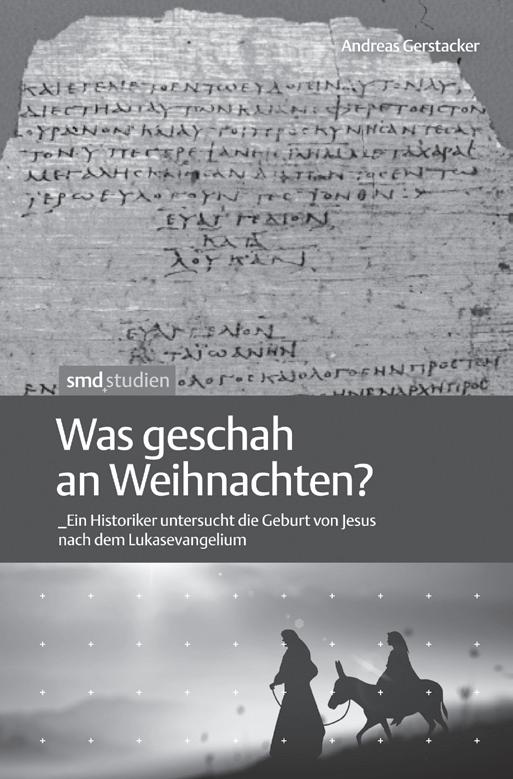
Andreas Gerstacker Was geschah an Weihnachten?
Ein Historiker untersucht die Geburt von Jesus nach dem Lukasevangelium
Edition SMD • 2016 • 96 S. • 5,00 €
Das Lukasevangelium berichtet detailreich, wie Jesus von Nazareth geboren wurde. Doch immer wieder weisen Kritiker auf historische Unstimmigkeiten hin, z. B. die Volkszählung unter Quirinius.
Der Historiker Andreas Gerstacker analysiert in dieser Studie den Bericht auf Basis des aktuellen Forschungsstandes mit historischer Akribie, wobei seine umfassende Fachkenntnis der damaligen römischen und jüdischen Kultur zum Tragen kommt. Erfrischend selbstkritisch stellt er auch fehlgeschlagene Harmonisierungsversuche dar.
Nach sorgfältiger Abwägung der Argumentationswege demonstriert er, warum ein Historiker weiterhin von der Zuverlässigkeit des Lukasevangeliums ausgehen kann.
„Empfehlenswert für jeden, der sich für die historische Zuverlässigkeit der Evangelien interessiert.“
Dr. Jürgen Spieß
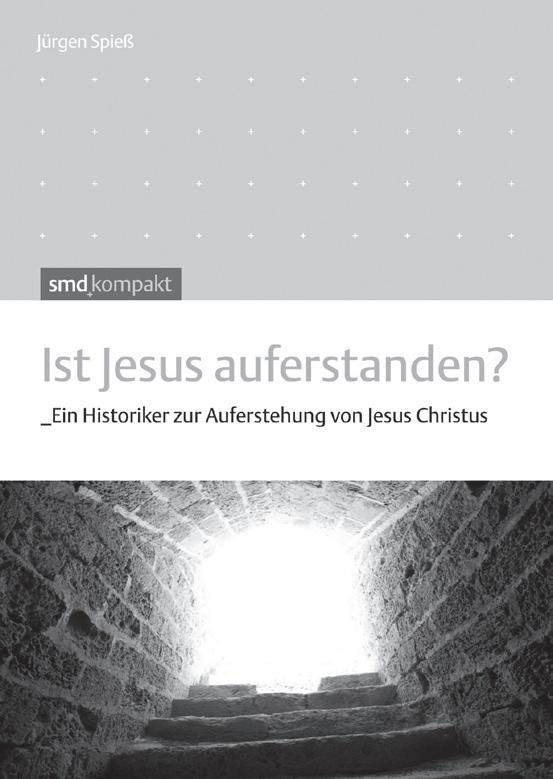
Jürgen Spieß Ist Jesus auferstanden?
SMD-Kompakt • 2011 • 48 S. • 1,00 €
An der Auferstehung von Jesus Christus scheiden sich die Geister. Für die einen ist Jesus tatsächlich auferstanden, andere sehen im leeren Grab Spielraum für ganz verschiedene Deutungen und Spekulationen, wieder andere halten die Auferstehung für ein Produkt der Fantasie.
Was berichten die Zeitzeugen? Welche Quellen gibt es? Und wie zuverlässig sind die Quellen? Der Autor gibt erhellende Einsichten in dieses spannende Thema.
Dr. Jürgen Spieß ist Althistoriker und Gründer des Instituts für Glaube und Wissenschaft (Marburg). Er wurde 1975 bei Hermann Bengtson in München über ein Thema der römischen Geschichte promoviert.
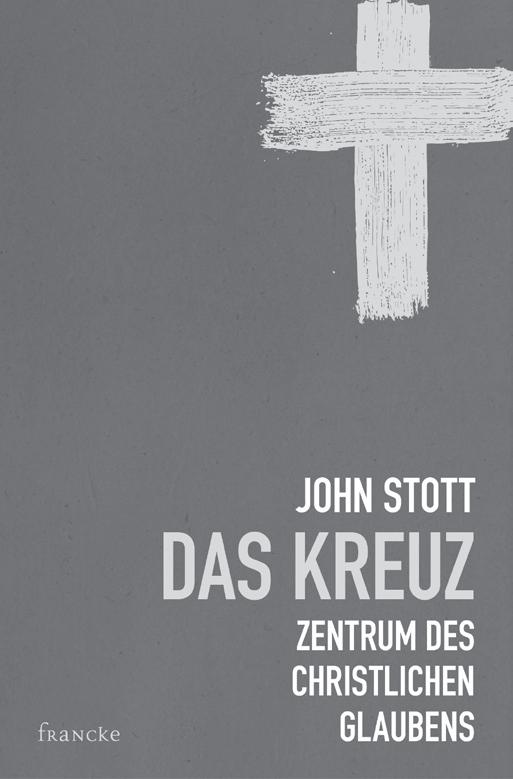
John Stott
Das Kreuz
Zentrum des christlichen Glaubens
SMD / Francke-Buch • 22019 • 528 S. • 12,95 €
Das Kreuz ist das zentrale Symbol des christlichen Glaubens. Was genau es damit auf sich hat und warum Jesus Christus sterben musste, ist vielen Menschen aber unbekannt.
John Stott erklärt tiefgründig und doch allgemein verständlich die Bedeutung des Kreuzes. In seiner sorgfältigen Studie kombiniert der Autor eine hervorragende biblische Auslegung mit dem fesselnden Ruf an jeden Christen, in der Nachfolge des Gekreuzigten zu leben. Gleichzeitig geht er auf moderne Anfragen an die biblische Lehre des stellvertretenden Sühnetodes ein.
In der englischsprachigen Welt avancierte John Stotts Buch zum Bestseller und wurde zu einem modernen Klassiker.
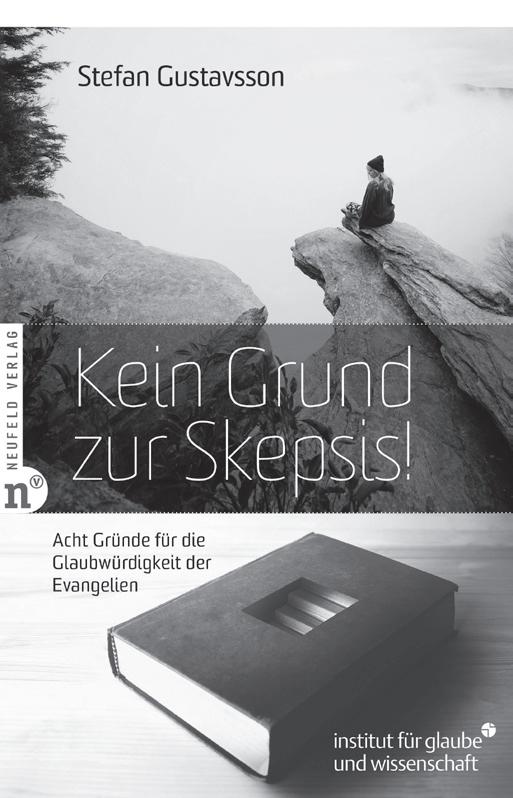
Stefan Gustavsson Kein Grund zur Skepsis!
Acht Gründe für die Glaubwürdigkeit der Evangelien Institut für Glaube und Wissenschaft / Neufeld 22019 • 188 Seiten • 9,90 €
Kein Grund zur Skepsis ist eine leicht lesbare und trotzdem tiefgehende Reise durch die Geschichte auf der Suche nach Antworten auf die Fragen, was wir eigentlich von Jesus wissen können, zu welchen Quellen wir Zugang haben und wie wir ihre Glaubwürdigkeit beurteilen können. Woher kommen die Informationen über Jesus? Wie stehen die Evangelien als historische Quellen im Vergleich zu anderen antiken Quellen da?
Stefan Gustavsson räumt ebenso unaufgeregt wie gründlich Einwände und scheinbare Widersprüche aus dem Weg. Er plädiert dabei für einen Umgang mit den biblischen Schriften, der der allgemeinen Vorgehensweise in den historischen Wissenschaften entspricht, und zeigt, warum man diesen Quellen grundsätzlich vertrauen kann.
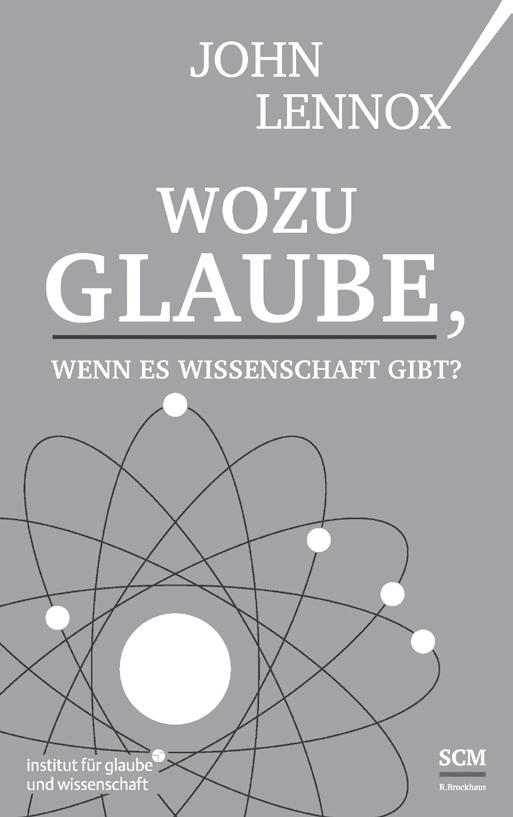
John Lennox Wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt?
Institut für Glaube und Wissenschaft / SCM R. Brockhaus • 2019 • 160 Seiten • 14,99 €
Ist christlicher Glaube in einer Welt der Wissenschaft, die uns das Universum erklärt, überhaupt noch zeitgemäß? Wofür brauchen wir noch einen Gott, wenn wir (fast) alles wissen und selbst erschaffen können? Ist Gott ein Auslaufmodell?
John Lennox sieht das anders: Glaube und Wissenschaft widersprechen sich nicht – sie ergänzen sich sogar! Wissenschaft muss nicht von Gott wegführen, sondern weist auf ihn hin. Es gibt gute und stichhaltige Argumente für den Glauben an Gott. Man kann auch „rational glauben“.
John Lennox, geb. 1943, ist emeritierter Mathematikprofessor an der Universität Oxford und Autor zahlreicher Bücher zum Verhältnis von Glaube, Ethik und Wissenschaft.
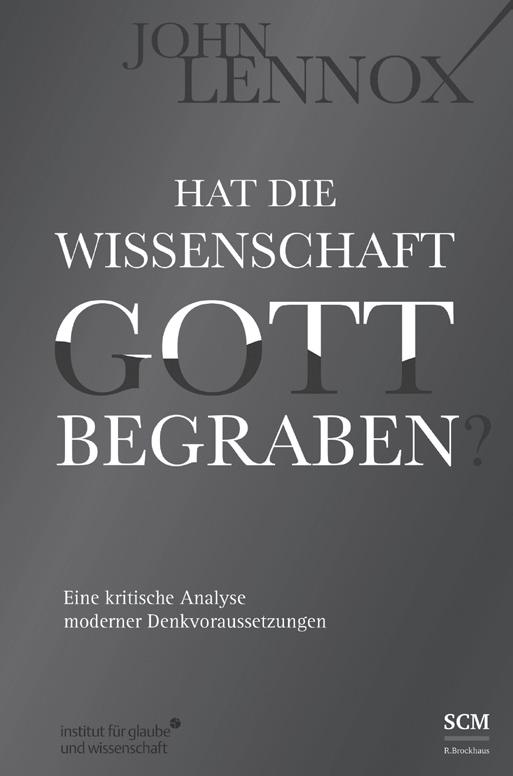
John Lennox
Hat die Wissenschaft Gott begraben?
Eine kritische Analyse moderner Denkvoraussetzungen
Institut für Glaube und Wissenschaft / SCM R. Brockhaus • 82019 • 327 S. • 18,99 €
Vor der Aufklärung war alles selbstverständlich: Keine Wissenschaft ohne die Prämisse Gott. Doch seitdem hat sich das Blatt gewendet: Gott wurde immer mehr an den Rand gedrängt und heute scheint er für die Wissenschaft völlig begraben zu sein. Aber wie ist die Welt sonst zu erklären? Ist die Komplexität der Natur ohne einen „Baumeister“, ohne eine dahinter stehende Intelligenz überhaupt denkmöglich?
John Lennox geht in diesem Buch den Voraussetzungen der modernen Naturwissenschaften auf den Grund. Dabei stehen Themen wie „Schöpfung und/oder Evolution“ und „anthropisches Prinzip“ im Mittelpunkt. Lennox berücksichtigt viele Grundideen, die in der wissenschaftlichen Diskussion in den letzten Jahren weit über den fachlichen Rahmen hinaus Aufsehen erregt haben.
Der NEUFELD VERLAG ist ein unabhängiger, inhabergeführter Verlag mit einem ambitionierten Programm.
Bei Gott sind Sie willkommen! Und zwar so, wie Sie sind.
Uns liegt am Herzen, dass Menschen erfahren:
• Der christliche Glaube ist keine Religion, sondern lebt von Beziehung.
• Es gibt nichts Besseres, als mit Jesus zu leben.
• Es lohnt sich, die Bibel für das eigene Leben zu lesen.
• Die Gemeinschaft mit anderen Christen fordert uns heraus und hilft uns.
Menschen mit Behinderung bereichern uns!
Sie haben uns etwas zu sagen und zu geben, zum Beispiel:
• Sie erinnern uns daran, dass jeder Mensch einzigartig ist.
• Sie zeigen uns, dass der Wert eines Menschen nichts mit seiner Leistungsfähigkeit zu tun hat
• Sie bremsen uns immer wieder aus und halten uns vor Augen, was im Leben wesentlich ist.
• Sie lassen uns erkennen, dass das Leben erfüllt sein kann –auch wenn es manchmal anders kommt als geplant.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder willkommen ist! neufeld-verlag.de
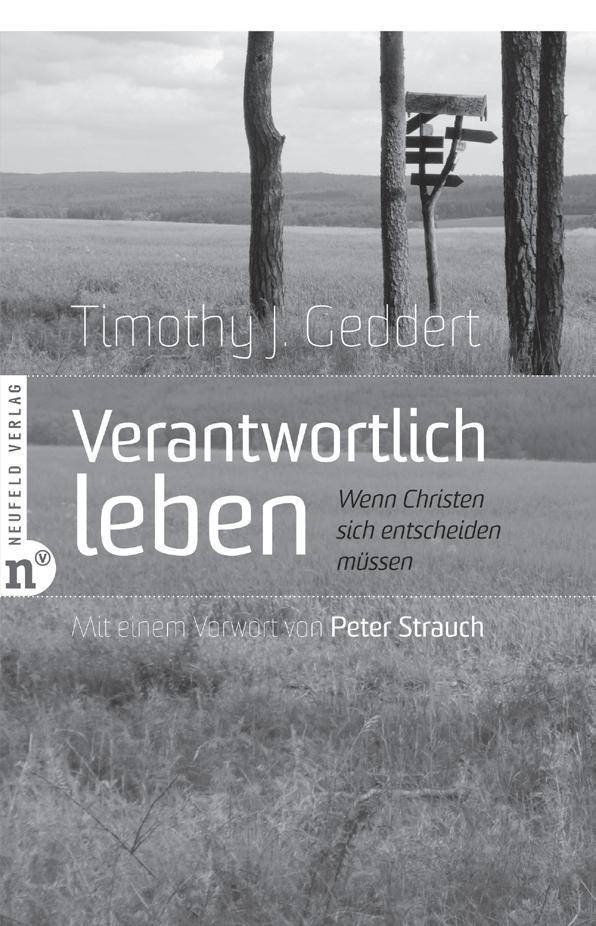
Timothy J. Geddert
Verantwortlich leben
Wenn Christen sich entscheiden müssen
52019 • 217 Seiten
Geht es die anderen etwas an, wie ich mit meinem Geld umgehe? Wie reagieren Kirchen und Gemeinden auf scheiternde Ehen? Wie steht die Bibel zu Homosexualität? Und wer sagt mir überhaupt, was richtig ist?
Wenn es um die „heißen“ Fragen in Sachen Ethik geht, stehen Christen und Gemeinden oftmals ratlos da: Die häufig schwarz-weißen Antworten von früher scheinen nicht mehr zu funktionieren.
Der Autor will konkrete Hilfe anbieten, wie Gemeinden aktuelle ethische Fragen besprechen und gegebenenfalls Richtlinien finden können. Dabei geht es um den Weg zwischen einer Regelorientierung, in der alles gesetzlich und objektiv betrachtet wird, und einer Unverantwortlichkeit, in der alles erlaubt ist und niemand etwas zu sagen hat.
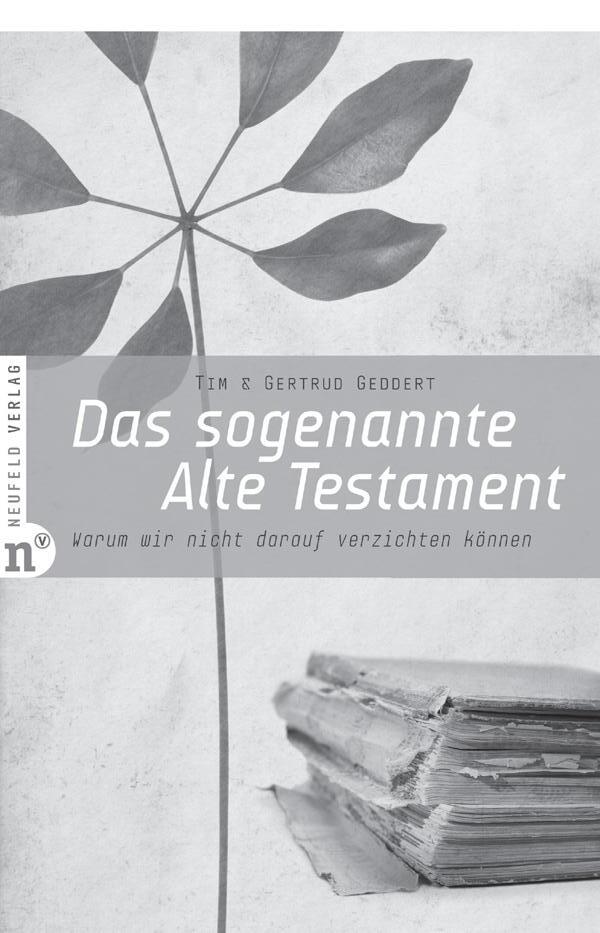
Timothy J. und Gertrud A. Geddert
Das sogenannte Alte Testament
Warum wir nicht darauf verzichten können
In Kooperation mit dem Bibellesebund 2009 • 158 Seiten
Wenn Christen zur Bibel greifen, schlagen sie automatisch das Neue Testament auf, als würde das Alte Testament nicht existieren. Im Grunde betrachten viele nur das Neue Testament als ihre Bibel. Dabei setzt es das fort, was das Alte Testament berichtet, begonnen und versprochen hat. Gemeinsam bilden sie die Bibel, die Gott uns gab.
Das Autorenpaar nimmt mit auf eine Entdeckungsreise ins Alte Testament und beschäftigt sich dabei auch ehrlich mit den „Problemzonen“, die vielen Christen Kopfzerbrechen bereiten.
Dabei wird deutlich: Die Bibel ist vom Anfang bis zum Ende faszinierend, lesenswert und unentbehrlich wichtig. Ohne sie wüssten wir fast nichts über den wahren Gott, wenig Zuverlässiges über den Sinn des Lebens und nur all zu wenig darüber, wie wir miteinander leben sollen.
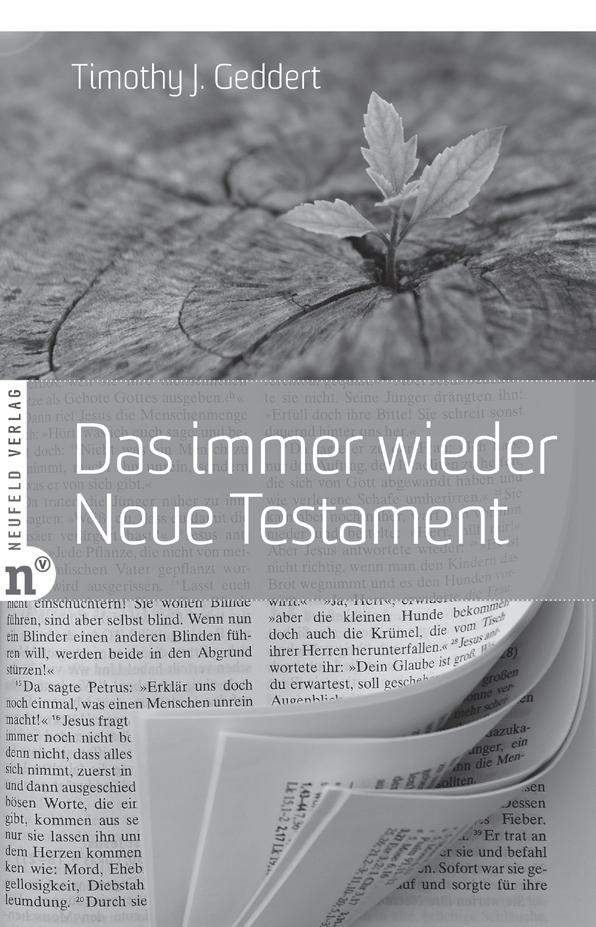
Timothy J. Geddert
Das immer wieder Neue Testament 2021 • 234 Seiten
Finden Sie die Bibel manchmal zu kompliziert?
Meinen Sie, die Heilige Schrift hat kaum etwas mit Ihrem wirklichen Leben zu tun? Sind Sie skeptisch, ob sie tatsächlich gute Nachrichten enthält? Damit sind Sie nicht alleine!
Tim Geddert hilft uns, das Neue Testament besser zu verstehen. Fragen ernst zu nehmen und gemeinsam nach Antworten zu suchen. Und damit zu leben, dass wir nicht alles begreifen.
Sein Buch weckt neu die Lust, die Bibel zu lesen, ja, mit der Bibel zu leben. Und dabei immer wieder Neues zu entdecken.
Nebenbei zeigt Geddert auch, dass es gründlich schief gehen kann, wenn wir die Bibel alleine lesen und interpretieren – und dann behaupten, wir hätten die ganze Wahrheit entdeckt.
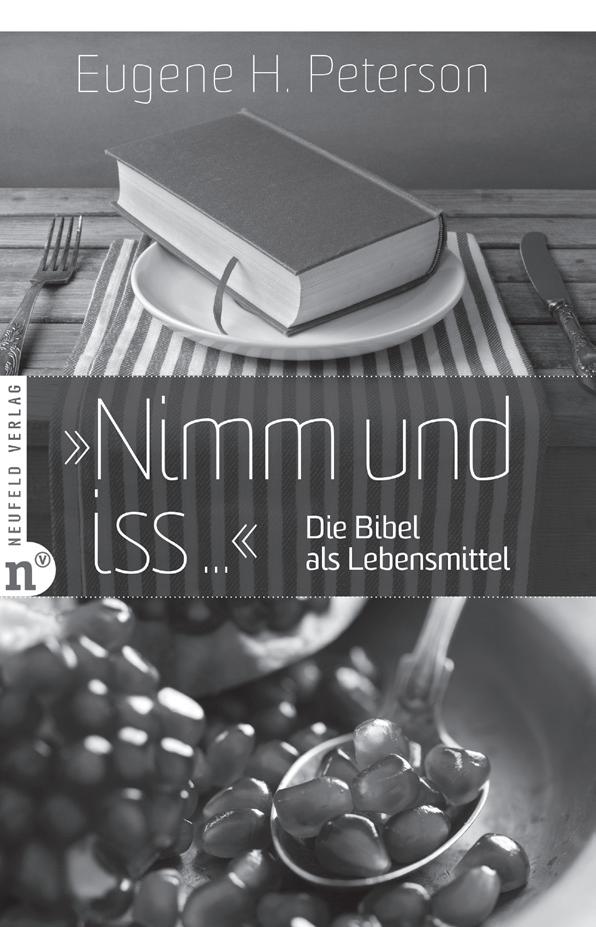
Eugene H. Peterson „Nimm und iss
…“
Die Bibel als Lebensmittel
Aus dem Amerikanischen von Evelyn Sternad 2014 • 224 Seiten
Sie ahnen etwas von der Kraft der Bibel, hätten aber gerne gewusst, was dieses Buch mit Ihrem Alltag zu tun hat?
Eugene H. Peterson fordert heraus, die Bibel auf eine andere Art zu lesen – so dass sie ein Text zum Leben und Wachsen wird, nicht nur um Wissen anzuhäufen oder Regeln zu befolgen. Dabei verleiht er der klugen Art eines bedächtigen Lesens, die sich im Laufe von Jahrhunderten entwickelt hat (Lectio Divina), eine neue Form für unsere Zeit.
„Nimm und iss dieses Buch“, lautet die Aufforderung, die Johannes im biblischen Buch der Offenbarung von einem Engel erhält. Peterson macht Mut, dieses Buch „zu essen“, in sich aufzunehmen, es zu leben und nicht nur zu lesen – und zwar erfrischend unkonventionell! Denn er ist überzeugt: Gott lädt uns heute noch ein, sein Wort in uns aufzunehmen: „Nimm und iss …“