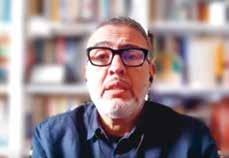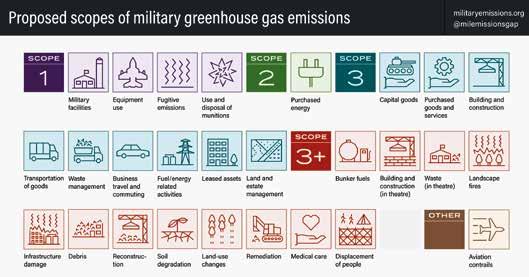ippnwforum
das magazin der ippnw nr178 juni 2024 3,50€ internationale ärzt*innen für die verhütung des atomkrieges – ärzt*innen in sozialer verantwortung

- Mythos „Targeted Killing“
- Türkei: Leben nach dem Erdbeben
- Gefährliche Atom-Fantasien
Klimaschutz ist Gesundheitsschutz:
Für ein gutes Leben in planetaren Grenzen
Anesu Freddy / UNDP Zimbabwe / CC BY-NC 2.0 Deed
AufrufandieneugewähltenEU-Abgeordneten
DieEUbrauchteineeigene atomareAbschreckung!
JoschkaFischer(Grüne),ehem.Bundesaußenminister NukleareAbschreckungistein unumgänglichesElementder Verteidigungdeseuropäischen Kontinents!
EmmanuelMacron,PräsidentderRepublikFrankreich Wirbrauchendie europäischeAtomwaffe!
ManfredWeber,FraktionsvorsitzenderderEVP
HelfenSieuns,dieEurobombezuverhindern!
JedeatomareAufrüstungderEUwäreeinmassiver VerstoßgegendenNichtverbreitungsvertragund würdedasRisikoeinesAtomkriegesweitererhöhen.
FriedenundSicherheitlassensichnichtmitnoch mehrAtomwaffenerreichen,sondernnurdurch RüstungskontrolleundEntspannungspolitik.
SendenSiedaherjetztunserenAufruf »Eurobombestoppen!«andieneugewählten AbgeordnetenimEuropaparlament!
AufrufanalleKandidierendenund AbgeordnetendesEU-Parlamentes

KostenloseFaltblättermitdemAufrufkönnenSiebestellen beiOhneRüstungLeben Arndtstraße31 • 70197Stuttgart • Tel.0711608396 • orl-info@gaia.de • undunter www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen
»
» »
FüreineEuropäischeUnion ohneAtomwaffen!
SpendenfürdieseAktion:OhneRüstungLeben • DE96520604100000416541 EineKooperationvonOhneRüstungLeben,IPPNWunddemTrägerkreis»Atomwaffenabschaffen – beiunsanfangen!«
PARTNER


Dr. Robin Maitra ist Vorstandsmitglied der deutschen IPPNW.
Die ökologische Krise, von der die Erderhitzung und der Verlust der Artenvielfalt nur die bedeutsamsten A spekte sind , ist die Megakrise unseres Jahrhunderts. Von der Intaktheit unserer Umwelt hängen menschliche Gesundheit, Wohlergehen und Prosperität in entscheidendem Maße ab.
Inzwischen werden in fast jedem Monat und Jahr neue Hitzerekorde vermeldet. In Deutschland ist die Temperatur seit 1881 um 1,8°C gestiegen und liegt damit bereits deutlich über den Zielen des Pariser Klimagipfels von 2015. Die Zeit wird knapper, in der ohne weitgehende Beschränkung eigener Bedürfnisse eine gutes Klimakonzept und eine Reduktion der Treibhausgasemissionen wirksam werden kann.
Dieter Lehmkuhl widmet sich in seiner Analyse dem derzeitigen Rollback in der Klimapolitik: Warum handelt die Gesellschaft angesichts der ökologischen Bedrohung nicht angemessen – und was gibt es für Lichtblicke, die einen transformativen Wandel in Aussicht stellen?
In Kenia betreffen die Auswirkungen des Klimawandels insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen. Dennis Opondo, Harrison Kuria Karime und Victor Chelashow von der IPPNW Kenia schildern, wie sich der Gesundheitsbereich auf die Anforderungen der Klimakrise vorbereitet. Wir berichten auch über Klimaschutzmaßnahmen im deutschen Gesundheitswesen: Hier haben sich die ersten Gemeinden auf den Weg gemacht, beteiligte Akteure zu vernetzen und regionale Aktionspläne zu entwickeln.
Laura Wunder gibt einen Überblick über die verheerenden Umweltauswirkungen des Krieges in Gaza. So hatten Anfang 2024 70 Prozent der Einwohner*innen Gazas kein sauberes Trinkwasser mehr. Über dies und vieles mehr berichtete der britische Geograf Benjamin Neimark in einem Onlinevortrag, den er im April 2024 bei der IPPNW hielt.
Die Fotos zu diesem Forum-Schwerpunkt stammen vom UN Development Programme und zeigen Bäuerinnen aus Simbabwe, die sich über klimafreundliche Landwirtschaft fortbilden. Frauen – die in der Landwirtschaft lange marginalisiert waren – treiben die Transformation des Sektors an. Sie stellen sich den Herausforderungen der Klimakrise und entwickeln wirtschaftliche Unabhängigkeit und Resilienz.
Eine anregende Lektüre wünscht –Ihr Dr. Robin Maitra
3 Grafik: Freepik.com EDITORIAL



4 IAEA-Gipfel: Gefährliche Atom-Fantasien 16
Abschiebung aus der Psychiatrie Klimabewegung: Wie geht es weiter? Adiyaman: Leben nach dem Erdbeben 8 Mythos „Targeted Killing“ 10 Iran-Israel: Flächenbrand mit atomarem Eskalationspotential 12 „We are survivors“: ICAN-Bildungsreise nach Kasachstan 14 Die nukleare Kette: Atomtests in Semipalatinsk 15 Gefährliche Atom-Fantasien 16 Aus der Psychiatrie in den Abschiebeflieger 18 Simbabwe: Bäuerinnen im Aufwind 20 Kenia: Klima und Gesundheit 22 Schwierige Zeiten für Klima- und Umweltschutz 24 Hitzeschutzmaßnahmen im deutschen Gesundheitswesen 27 Klima- und Umweltfolgen des Gazakrieges 28 UN Civil Society Conference in Nairobi 30 Editorial 3 Meinung 5 Nachrichten 6 Aktion 31 Gelesen, Gesehen 32 Gedruckt, Geplant, Termine 33 Gefragt: Rolf Bader 34 Impressum/Bildnachweis 33 INHALT THEMEN SCHWERPUNKT WELT RUBRIKEN 24 18 24 Saulo Zayas / pexels.com © Eric de Mildt / Greenpeace
Unverhältnismäßig:
Im Mai 2024 kündigte der russische Präsident Wladimir Putin atomare Übungen an der ukrainischen
Grenze
an. Die IPPNW warnte erneut vor einer Eskalation des Ukrainekrieges zum Atomkrieg.

Dr. Inga Blum ist Mitglied im internationalen Vorstand der IPPNW.
Alle Atomwaffenstaaten müssten sich in einem ersten Schritt vertraglich verbindlich verpflichten, auf einen Ersteinsatz von Atomwaffen zu verzichten und Atomwaffen aus der höchsten Alarmbereitschaft zu nehmen. Mit diesem Vorschlag, die chinesische Atomwaffendoktrin des „No first use“ aufzugreifen, sollten die Atomwaffenstaaten USA, Großbritannien und Frankreich auf Russland zugehen. Ein solches Vorgehen könne zudem die geopolitische Rivalität zwischen China und den USA entspannen.
„Taktische“ Atomwaffen sind bei weitem nicht harmlos – sie können bis zu 20 Mal zerstörerischer sein als die Bombe, die die USA auf Hiroshima abgeworfen haben. Damit sollen die russischen Atomübungen Militärpersonal darauf trainieren, innerhalb von Sekunden Massenmorde an Zivilist*innen zu begehen.
Die glaubhafte Drohung mit Atomwaffen ist ein integraler Bestandteil der nuklearen Abschreckung. Alle Atomwaffenstaaten üben regelmäßig Einsatzszenarien mit Atomwaffen, modernisieren ihre Arsenale und entwickeln die politischen Rahmenbedingungen, um Atomwaffen als glaubhaftes Mittel der Außenpolitik zu stärken. Die jüngsten russischen Drohungen wie auch die jährlichen Steadfast-Noon-Manöver der NATO oder die nordkoreanischen Raketentests sollen genau diesen Zweck erfüllen.
Ein nüchterner Blick auf diese Entwicklungen zeigt, dass Atomwaffen als Instrument der Einschüchterung und Erpressung funktionieren, nicht als Stabilisierungsfaktoren. Solange Atomwaffen als legitimes Mittel der Außenpolitik gelten, besteht die Gefahr, dass Staatschefs wie Putin oder Kim Jong Un diese Waffen auch einsetzen. Drohungen mit Atomwaffen sollten daher konsequent und kategorisch verurteilt werden, um die Waffen und deren Besitzerstaaten zu stigmatisieren.
Um jedoch glaubhaft nukleare Drohungen zu verurteilen, ist der Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) nötig. Der AVV ist der einzige multilaterale Vertrag, der Atomwaffen verbietet und einen konkreten Fahrplan hin zu einer Welt ohne Atomwaffen bereit hält. Wenn wir Atomwaffen delegitimieren wollen, müssen wir dafür sorgen, dass alle Staaten dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten.
5 MEINUNG

Die IPPNW öffnet sich für weitere Gesundheitsberufe
Die IPPNW öffnet sich erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1982 für andere Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen. Das haben die Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierenden auf der Mitgliederversammlung am 27. April 2024 in Frankfurt am Main beschlossen. Neben Medizinstudierenden und approbierten Psycholog*innen sind nun unter anderem auch Pflegekräfte, Apotheker*innen, medizinisch-technische Assistent*innen, Hebammen oder Notfallsanitäter*innen eingeladen, Vollmitglied bei der IPPNW zu werden.
Die ärztliche Sonderstellung, die die Ärzteschaft im Medizinsystem früher hatte, habe so keinen Bestand mehr, lautete die Begründung. Heute gebe es eine starke Akademisierung auch anderer Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Damit folgt die deutsche Sektion den vielen internationalen IPPNW-Sektionen nach, die diesen Schritt bereits getan haben. So zum Beispiel die US-amerikanische Sektion „Physicians for Social Responsibility“ oder die britische Sektion „Medact“.
Die IPPNW engagiert sich für eine menschenwürdige Welt frei von atomarer Bedrohung und für Frieden weltweit. Sie setzt sich ein für die Ächtung jeglichen Krieges, für gewaltfreie, zivile Formen der Konfliktbearbeitung, für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und die gerechte Verteilung von Ressourcen sowie für ein soziales und humanes Gesundheitswesen.
Mehr im Forum intern, S.8f.


UN: IPPNW fordert Repräsentanz atomwaffenfreier Staaten
Anlässlich der Civil Society Conference der Vereinten Nationen, die am 9. und 10. Mai 2024 in Nairobi (Kenia) stattfand, mahnte die IPPNW Deutschland weitreichende Reformen in der Struktur der UN an. Die Vereinten Nationen seien in ihrer jetzigen Form nicht in der Lage, angemessen auf die existenziellen Bedrohungen durch Atomwaffen oder die Klimakrise zu reagieren.
Die fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat sind alle Atomwaffenstaaten, die zwar den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet haben, aber die daraus resultierende Verpflichtung zur Abrüstung der Atomwaffen bis heute nicht eingelöst haben. Die IPPNW fordert daher eine stärkere Repräsentanz der atomwaffenfreien Staaten im UN-Sicherheitsrat. Daher solle ein Staat, der den Atomwaffenverbostvertrag unterzeichnet habe, in die Gruppe der ständigen Mitglieder aufgenommen werden.
Der UN-Atomwaffenverbotsvertrag und der Prozess, wie dieser in Kraft getreten ist, könne als Wegweiser dienen, um die notwendigen Veränderungen in der Struktur des derzeitigen Sicherheitsrates einzuleiten und atomwaffenfreien Stimmen eine Vertretung im Sicherheitsrat zu geben.
An der Konferenz nahmen über 500 NGOs von allen fünf Kontinenten, Botschafter*innen und auch Präsident*innen afrikanischer Staaten teil. Die Ergebnisse der Konferenz fließen in den Zukunftsgipfel der UN in New York im im September 2024 ein.
Mehr auf S. 30 und 34 sowie unter: www.un.org/en/summit-of-the-future
Zivilgesellschaft ist gemeinnützig!
Über 4 05.000 Menschen haben seit dem Attac-Urteil die Unterschriftensammlung „Zivilgesellschaft nützt der Gemeinschaft: Politische Beteiligung ist gemeinnützig!“ unterschrieben, die die Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“ ins Leben gerufen hatte. Die Unterschriften sollen bald an Bundesfinanzminister Christian Lindner übergeben werden
Im April 2014 erkannte das Finanzamt Frankfurt Attac die Gemeinnützigkeit ab, mit der Begründung, das Netzwerk agiere zu politisch. Campact und Change.org folgten. Nacheinander verloren kleine und große Organisationen und Vereine die Gemeinnützigkeit, weil sie sich „politisch einmischen“.
Die Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“ ist ein Zusammenschluss von fast 200 Vereinen und Stiftungen, der sich für ein modernes Gemeinnützigkeitsrecht einsetzt, das demokratisches zivilgesellschaftliches Engagement fördert, statt es zu behindern. Aktuell sind Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich regelmäßig politisch äußern, ständig der Gefahr ausgesetzt, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren. Das will die Allianz ändern und Rechtssicherheit durch gesetzliche Klarstellungen schaffen: „Die Forderungen des Appells sind eigentlich das, was die Ampel-Koalition vereinbart hat. Doch im bekannt gewordenen Entwurf des Jahressteuergesetzes aus dem Hause Lindner ist nichts davon drin.“
Unterschreiben unter: zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de
6 Symbolbild: Edmund Dantès / pexels.com
NACHRICHTEN

Erneut Atomwaffengegner*innen wegen Sit-in vor Gericht
Wegen Zivilen Ungehorsams auf dem Atomwaffen-Stützpunkt Büchel standen am 13. Mai 2024 zwei Friedensaktivist*innen vor Gericht. Die beiden hatten sich vor einem Jahr an einem gewaltfreien Sit-in beteiligt. Dafür wurden sie vom Amtsgericht Cochem zu jeweils 60 Tagessätzen wegen Hausfriedensbruchs verurteilt.
Die Angeklagten argumentierten, mit der atomaren Teilhabe Deutschlands und dem täglichen Üben eines Atomwaffenabwurfes durch deutsche Soldat*innen verstoße die Bundesrepublik Deutschland gegen Völkerrecht und Grundgesetz. Das Völkerrecht verbiete den Einsatz und die Drohung mit dem Einsatz dieser gefährlichsten Massenmordwaffe ohne Ausnahme. Mit der atomaren Teilhabe verstoße die Bundesrepublik Deutschland zudem gegen den Artikel 2 des Nichtverbreitungsvertrages (NPT) sowie den Einigungsvertrag (Zwei-plus-Vier-Vertrag).
„Das Grundgesetz bestimmt klar, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts den Bundesgesetzen vorgehen“, so Friedensaktivist Ernst-Ludwig Iskenius. Deshalb forderten die Angeklagten das Gericht auf, mit einer Richtervorlage an das Bundesverfassungsgericht Klarheit über diese Rechtsbrüche deutscher Atomwaffenpolitik herbeizuführen. Leider lehnte es das Gericht, wie auch bei anderen Prozessen zu diesem Thema, ab, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen.

Ärztetag
fordert Gesundheitskarte für Geflüchtete
Der 128. Deutsche Ärztetag hat Verantwortliche in Bund und Ländern aufgefordert, auf eine flächendeckende Versorgung Geflüchteter mit einer elektronischen Gesundheitskarte hinzuwirken. Ein entsprechender Beschluss des Ärztetages kritisiert, dass Geflüchtete bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens nur einen eingeschränkten Anspruch auf die Gewährung von Gesundheitsleistungen haben. Die Erlangung medizinischer Leistungen sei für sie durch den komplizierten Zugang erheblich erschwert.
Obwohl im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, „den Zugang für Asylbewerberinnen und Asylbewerber zur Gesundheitsversorgung unbürokratischer zu gestalten“, hat die Ampelkoalition die Asylgesetzgebung massiv verschärft. Anfang des Jahres hat sie auch den Zeitraum, in dem Flüchtlinge geringere Leistungen beziehen, von 18 auf 36 Monate verlängert –diese Änderung werde zur erheblichen Verlängerung der derzeit bereits hohen Wartezeiten im Gesundheitsbereich führen. Damit bestehe die Gefahr, dass die Verschleppung notwendiger Behandlungen zu einer vermeidbaren Verschlimmerung von Krankheitsverläufen und zur Chronifizierung führe. Eine elektronische Gesundheitskarte für Geflüchtete mit definierten Leistungs- und Abrechnungskriterien vereinfache und verbessere die Behandlung Geflüchteter. Sie erleichtere den Zugang zur Gesundheitsversorgung während der Wartezeit und könnte zumindest die negativen Konsequenzen der jetzt beschlossenen Ausweitung des Asylbewerberleistungsgesetzes etwas abmildern.
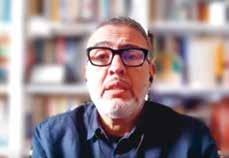
IPPNW kritisiert Einreiseverbot für britisch-palästinensischen Arzt
Am 12. April 2024 wurde dem britischpalästinensischen Chirurgen Dr. Ghassan Abu Sittah, Rektor der Universität Glasgow, die Einreise nach Deutschland verweigert. Die IPPNW protestierte gegen die verweigerte Einreise und das politische Betätigungsverbot in einen Brief an Bundesinnenministerin Faeser. Sie forderte die Bundesregierung auf, offenzulegen, auf welche rechtliche Grundlage sie sich stütze.
Abu Sittah ist ein mehrfach ausgezeichneter plastischer Chirurg, Experte für traumatische Verletzungen und war bereits an vielen Kriegsschauplätzen im Einsatz. Auf dem Palästinakongress in Berlin wollte er über seine Tätigkeit für Ärzte ohne Grenzen (MSF) im Shifa- und im Ahli-Krankenhaus in Gaza berichten, wo er sechs Wochen lang Verwundete behandelt hat.
Abu Sitta hatte unter anderem über die Zustände im Al-Shifa-Krankenhaus berichtet. Dort ist in den letzten Wochen ein schreckliches Ausmaß an Zerstörung ans Licht gekommen. Es gibt Berichte über den Fund von 300 Toten, Folter und Massenexekutionen. Laut Augenzeugen begrub das israelische Militär Leichen mit Raupenfahrzeugen. Mitarbeiter*innen einer benachbarten MSF-Klinik bestätigten diese Angaben. Das Al-Shifa-Krankenhaus war mit ca. 700 Betten eines der größten und wichtigsten Krankenhäuser des Gazastreifens.
Inzwischen hat das Verwaltungsgericht Potsdam in einem Eilbeschluss das Schengen-Einreiseverbot für den Arzt gekippt. Diese Entscheidung hat EU-weite Bedeutung.
7 Videostill von Democracy Now NACHRICHTEN
Adiyaman: Leben nach dem Erdbeben
Zu Besuch bei der Ärzte- und Anwaltskammer in der Krisenregion
Unsere kurdischen Freunde aus Diyarbakir arbeiten mit ihren NGOs in Adiyaman. Letztes Jahr war eine Reise dorthin für uns nicht möglich. In diesem Jahr konnten wir uns einen Eindruck verschaffen. Die Fahrt von Diyarbakir dauert etwa zweieinhalb Stunden. Zwei kurdische Freund*innen fuhren uns, zwei weitere kamen in Adiyaman dazu. Wir hatten im März 2024 Termine bei der Rechtsanwaltskammer, einem Kinderprojekt, bei der Ärztekammer, bei einer Plattform für die Erdbebenhilfe verschiedener NGOs und der Gewerkschaft für den Öffentlichen Dienst KESK.
Von unseren Fahrzeugen aus konnten wir einen Eindruck von den Zerstörungen und Beschädigungen und vom Ausmaß des Wiederaufbaus gewinnen. Wir sahen viele Baulücken, teilweise noch mit Geröll. Viele Häuser erschienen nur auf den ersten Blick intakt. Auf den zweiten Blick sahen wir, dass sie Risse hatten. Dennoch waren sie teilweise bewohnt. Bauarbeiten konnten wir auch sehen, allerdings nach meinem Eindruck nur in mäßigem Umfang. Später hörten wir bei unseren Gesprächen, dass der Wiederaufbau nur schleppend vorankomme.
Adiyaman hatte vor dem Erdbeben rund 550.000 Einwohner*innen. Von verschiedener Seite hörten wir, dass die türkische Regierung die Zahl der Toten mit 9.000 beziffere, tatsächlich jedoch zwischen 78.000 und 80.000 Menschen ums Leben gekommen seien. Dies sei eine grobe Schätzung von NGOs, die Statistiken über nicht mehr erreichbare Telefon- und Handyanschlüsse ausgewertet
hätten. Viele, die wir treffen, haben Angehörige verloren und leben in Containern. Vor allem die Ärzt*innen und Anwält*innen wirken auf mich traurig und angespannt. Nur die syrischen Flüchtlingskinder im Kinderprojekt sind fröhlich und zeigen uns stolz ihre Kunstwerke.
Das repräsentative Bürohaus der Rechtsanwaltskammer hat das Erdbeben unbeschädigt überstanden. Aber, so erfahren wir vom Präsidenten der Anwaltskammer, 80 % der Anwaltsbüros wurden zerstört. Zunächst war eine berufliche Tätigkeit kaum möglich. Wie viele andere wurden auch die Anwält*innen in Zelten und später Containern untergebracht und waren von täglichen Essensrationen abhängig. Inzwischen stehen viele vor dem finanziellen Ruin: Ein Großteil ihrer Mandant*innen ist entweder ums Leben gekommen oder fortgegangen oder hat kein Geld.
Von den Ärzten werden wir vor Containern empfangen. Sie berichten uns, dass das Kinder- und Geburtskrankenhaus und andere Gesundheitseinrichtungen zerstört wurden und nur ein Krankenhaus erhalten blieb. Ca. 18.300 Menschen haben bleibende Schäden erlitten. Die Ärzt*innen waren Tag und Nacht im Einsatz. Vom Präsidenten der Ärztekammer erfahren wir, er habe nach dem Verlust mehrerer Angehöriger Medikamente genommen, um arbeiten zu können. Für eine psychologische Behandlung sei gar keine Zeit gewesen.
Behinderung von Hilfseinsätzen
Bei unserem Besuch in Van und Diyarbakir im letzten Jahr hörten wir viele Klagen,

dass der staatliche Katastrophenschutzdienst AFAD zu spät und unzureichend ausgestattet in die Erdbebenregion gekommen sei. Das wird auch durch unsere Gesprächspartner in Adiyaman bestätigt. Ein erstes Hilfsteam sei nach vier Tagen aus Finnland eingetroffen. Als der AFAD dann dagewesen sei, habe er jegliche Zusammenarbeit mit nicht dem Regierungslager nahestehenden Organisationen abgelehnt und sie sogar blockiert.
Bei der KESK erfahren wir, die Polizei habe Vermieter von Depots für Hilfslieferungen gezwungen, den Hilfsorganisationen zu kündigen. Hilfsteams aus Diyarbakir und Batman seien von der Polizei gestoppt und sogar zusammengeschlagen worden.
Von den Vertreter*innen der Anwaltskammer wird uns mitgeteilt, reiche Geschäftsleute seien in die Containerstädte gefahren und hätten dort Geldgeschenke „mit einem lieben Gruß von der Regierung“ verteilt. Die Container, die regierungsnahe Kreise von AFAD erhalten hätten, seien gut ausgestattet. Dagegen habe der AFAD der Anwaltskammer für ihre Mitglieder nur einen einzigen Container mit sehr kleinen Räumen und ohne Stromversorgung zur Verfügung gestellt.
Das Leben in Containern auf engem Raum erhöht das Risiko von Krankheiten und führt zu Spannungen unter den Menschen, die dort wohnen. Von einer Sozialarbeiterin erfahren wir, dass ihre Organisation durch Aufklärung der Familien und Verteilung von Cremes und Shampoos gegen die Ausbreitung von Läusen und Krätze kämpft. Andere berichten, häusli-
8 FRIEDEN

ADIYAMAN: BÜROS IN CONTAINERN, MÄRZ 2024
che Gewalt habe extrem zugenommen. Es gibt eine hohe Rate von Scheidungen. Die Zahl der Selbstmorde, vor allem von älteren Menschen, hat sehr stark zugenommen. Bei KESK erfahren wir, dass allein im Februar 2024 zehn Menschen Selbstmord begangen haben, Selbstmordversuche nicht mitgerechnet, ein Großteil von ihnen älter als 65 Jahre. Wer die Möglichkeit dazu hat, zieht daher in andere Regionen der Türkei oder ins Ausland. Die massive Abwanderung von Ärzt*innen belastet die Gesundheitsversorgung zusätzlich.
Juristische Aufarbeitung der Verantwortlichkeit für die Folgen des Erdbebens
Der Präsident der Anwaltskammer berichtet uns, die Gerichte begönnen nun mit Verfahren gegen Bauherren, in denen Schadensersatzansprüche geltend gemacht würden. Verfahren gegen Behördenmitarbeiter*innen, die für die Bebauungspläne zuständig gewesen seien, hätten die Gerichte bislang jedoch nicht zugelassen. 2021 habe es eine Untersuchung des AFAD gegeben, der vor schweren Erdbeben in Adiyaman gewarnt und eine Einstufung als Erdbebengebiet ersten Grades für erforderlich gehalten habe. Tatsächlich sei Adiyaman aber als Erdbebengebiet zweiten Grades eingestuft worden. Wegen dieser Falscheinstufung gebe es bisher vor keinem Gericht ein Verfahren. Vielmehr werde die Schuld auf den privaten Sektor, nämlich Bauherren und Architekten, abgeladen, die sich an der Einstufung als Erdbebengebiet zweiten Grades orientiert hätten.

ZU BESUCH BEIM KINDERPROJEKT
Verringerung der Bandbreite des Mobilfunknetzes
Bei unserem Gespräch mit den Vertretern der Ärztekammer und der KESK wurden wir auch darauf aufmerksam gemacht, dass die türkische Telekommunikationsbehörde zwei Tage nach dem Erdbeben, am 8. Februar 2023 die Bandbreite des Mobilfunknetzes für mehrere Stunden beschränkt hat. Menschen, die unter den Trümmern lagen, hätten deshalb ihr Mobiltelefon nicht nutzen und Angehörige nicht kontaktieren können. Bei der Ärztekammer heißt es, zu jener Zeit hätten verschüttete Menschen noch gelebt, die später erfroren seien. Meine spätere Recherche ergibt, dass die Nachrichtenagentur Reuters darüber am 9. Februar 2023 berichtet und mitgeteilt hat, dass die Sperre nach zwölf Stunden wieder aufgehoben wurde.
Einer unserer Gesprächspartner bei KESK erklärt, der Minister für Transport und Infrastruktur Abdulkadir Uraloglu habe die Maßnahme in einem Interview mit einem Journalisten gerechtfertigt und erklärt, die Regierung habe sie anordnen müssen, weil andernfalls ihr Ansehen beschädigt worden wäre. In Ankara werde ich auf Prof. Dr. Akdeniz von der Vereinigung für Meinungsfreiheit hingewiesen, der versucht, herauszufinden, wie und warum die Entscheidung zur Verengung des Frequenzbandes getroffen wurde. Unter Berufung auf das 2003 von der Großen Türkischen Nationalversammlung verabschiedete Gesetz über den Zugang zur Information hat er unmittelbar nach dem Vorfall einen Antrag auf Auskunftserteilung bezüglich der
Banddrosselung gestellt. Ihm wurde lediglich geantwortet: „Aufgrund der Tatsache, dass Desinformations- und Manipulationsveröffentlichungen, die den Kampf gegen die Erdbebenkatastrophen … direkt beeinflussen und manchmal stören, Angst, Panik und Unordnung in der Gesellschaft verursachen können, wurden im Rahmen des zehnten Absatzes von Artikel 60 des Gesetzes über die elektronische Kommunikation Nr. 5809 die notwendigen Maßnahmen ergriffen, die vom Richter genehmigt wurden.“
Daraufhin hat Akdeniz beim 15. Verwaltungsgericht Ankara Klage erhoben und beantragt, dass ihm Kopien der maßgeblichen Beschlüsse zugeleitet werden. Die Klage war erfolgreich. Jedoch ist das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Prof. Akdeniz ist ein beharrlicher Streiter für das Recht auf Meinungsfreiheit nach Art. 10 EMRK. In zwei Beschwerdeverfahren vor dem EGMR war das Gericht der Auffassung, dass ihm die Opfereigenschaft im Sinne von Art. 34 EMRK fehle und die Beschwerde damit nicht zulässig sei. Seine dritte Beschwerde ist absehbar, wenn die höheren Instanzen in der Türkei anders als das Verwaltungsgericht Ankara entscheiden.
Ingrid Heinlein ist Sprecherin der Fachgruppe Internationales der Neuen Richtervereinigung und reiste 2023 und 2024 mit der IPPNW in den Südosten der Türkei.

9
Fotos:
Susanne Dyhr
Mythos „Targeted Killing“
Nein zur technischen Rationalisierung von Krieg!

Dieser Beitrag stützt sich auf die investigative Recherche des israelischen Journalisten und Filmemacher Yuval Abraham zu dem KI-gestützten System „Lavender“, die am 3. April im israelisch-palästinensischen Magazin +972 veröffentlicht wurde. Sie folgte auf Abrahams Recherche vom November 2023 zu einem KI-gestützten Befehls-, Kontroll- und Entscheidungsunterstützungssystem des israelischen Militärs (IDF), „The Gospel“, zur Markierung von Gebäuden, aus denen heraus HamasKämpfer operieren. „Lavender“ dagegen markiert nicht Gebäude oder Landstriche, sondern Menschen. Es wird eingesetzt, um Militärs der Hamas und des islamischen Dschihad zu identifizieren und erstellt eine Liste von Personen, die getötet werden sollen. Laut Zeugenaussagen würden vor allem die Wohnungen angegriffen – nachts, wenn normalerweise die ganze Familie anwesend ist, da sie in den Wohnungen leichter zu lokalisieren seien. Dazu werde u.a. ein weiteres System „Where is Daddy?“ aktiviert, was die Verdächtigen verfolgt und nach Betreten des Hauses bombardiert.
Erinnerungen an den „War on Terror“
Nicht wenige Formulierungen, die Yuval Abraham und die interviewten Soldat*innen benutzen, erinnern an die Hoch-Zeit des War on Terror der USA nach dem elften September 2001. Das Töten von Familien als Kollateralschäden, maschinell generierte Todeslisten, die Senkung der Schwelle bei der Definition eines Terroristen, die erzeugte psychische Distanz, das falsche Versprechen von „gezielten Tötungen“, mit weniger zivilen Opfern – es liest sich fast wie ein Upgrade des US-Drohnenkrieges.
Nach 2001 wurden vom Pentagon Förderprogramme entwickelt im Bereich der rechnergestützten sozialen Netzwerk-
analyse, bzw. den Computational Social Science (CSS), und dem Natural Language Processing (NLP), der komputativen Verarbeitung natürlicher Sprache. Datenanalyse-Unternehmen wie Palantir, die auch in weiteren Kriegen und Konfliktenderzeit eine Rolle spielen, begannen damals ihre Imperien aufzubauen. Diese ITUnternehmen spezialisierten sich auf die Überwachung von Individuen und die Zusammenführung getrennter Datenbestände und wurden so zu bedeutenden Playern. „Project Maven“, SKYNET, „Gorgon Stare“, Palantirs „MetaConstellation“ in der Ukraine oder die „Artificial Intelligence Platform (AIP) for Defense“, die mit großer Wahrscheinlichkeit derzeit auch in Gaza zum Einsatz kommt, zeigen, welchen Weg Staaten und Technologieunternehmen im War on Terror einschlugen.
High-Tech-Krieg
Die Hemmschwelle, sich bei militärischen Operationen auf solche komplexen informationsverarbeitenden Systeme zu verlassen, ist drastisch gesunken. Wie in den obigen Systemen sind auch in Lavender Machine-Learning-Komponenten implementiert. Sie analysieren algorithmisch bzw. mit statistischen Methoden Daten, um Muster in ihnen zu erkennen. Diese wiederum dienen als Basis für automatisierte Empfehlungen an Führungs- und Einsatzkräfte, um sie auf verschiedenen Ebenen der Befehlskette bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Aus diesem Grund spricht man bei dieser Technologie auch von einer datengetriebenen.
Die IDF setzten, +972 zufolge, insbesondere in den ersten Wochen nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 großes Vertrauen in Lavender.
Doch wie beim US-amerikanischen Drohnenprogramm, das zu sehr vielen zivilen Todesopfern führte, so war auch in den
IDF laut den zitierten Zeugen ein Wissen um die technische Fehleranfälligkeit vorhanden. Dies gilt sowohl für rein technische Fehler, als auch für Fehler im Erkenntnisgewinn durch KI-gestützte Systeme zur militärischen Entscheidungsunterstützung.
Israelische Geheimdienstmitarbeiter*innen überprüften angeblich manuell die Genauigkeit von Lavender an Zufallsstichproben und fanden eine 90-prozentige Treffergenauigkeit. Die methodische Umsetzung und die völkerrechtlichen Maßstäbe dieser stichprobenhaften Überprüfung sind nicht bekannt, sodass daraus nur zu schließen ist, dass zehn Prozent möglicher ziviler Opfer in Kauf genommen wurden. Insbesondere unter Verwandten, Nachbarn, Zivilschutzbeamten und Polizisten wurden falsche Identifizierungen durch Lavender festgestellt. Ebenso bei Personen, die zufällig denselben Namen oder Spitznamen trugen oder ein Mobilfunktelefon benutzten, das zuvor einem HamasKämpfer gehört hatte.
Collateral Murder
Den interviewten Soldaten zufolge entschied die Armee in den ersten Kriegswochen, dass bei niedrigrangigen HamasMilitärs 5–20 zivile Todesopfer toleriert werden könnten. Bei ranghohen Kämpfern sollen laut Bericht mehr als 100 zivile Opfer als akzeptabel angesehen worden sein. Die konkrete Zahl der tatsächlich anwesenden und getöteten Zivilist*innen wurde mit ziemlicher Sicherheit anschließend kaum überprüft.
Daniel Hale, ein ehemaliger Geheimdienstanalyst der US Air Force, der am 27. Juli 2021 zu 45 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil er Regierungsdokumente durchsickern ließ, sagte, dass „bei der Drohnenkriegsführung manchmal neun von zehn Getöteten unschuldig“ seien:
10
Harun Farocki: „War at a Distance“ (2003)
„Du musst einen Teil deines Gewissens töten, um deinen Job zu machen.“
Eine psychologische Distanz zu den potentiellen zivilen Opfern muss demnach Soldatinnen und Soldaten nicht nur antrainiert werden, sie muss auch kontinuierlich aufrechterhalten bleiben. Auch ein Töten auf abstrakter Ebene und mit räumlicher Distanz lässt viele Drohnenpilot*innen laut eigener Aussage nicht kalt. Die technischen Systeme lösen lediglich Teile von Mitleid, von Trauer oder Hass aus den Herzen der Soldat*innen. So die Aussage eines Soldaten im Gespräch mit +972: „Der stati-stische Ansatz hat etwas an sich, das Soldaten auf eine bestimmte Norm und einen bestimmten Standard festlegt. Bei diesen Operationen kam es zu einer unlogischen Anzahl von Bombenangriffen. Das ist in meiner Erinnerung beispiellos. Ich habe jedoch mehr Vertrauen in einen statistischen Mechanismus als in einen Soldaten, der vor zwei Tagen einen Freund verloren hat. Alle dort, mich eingeschlossen, haben am 7. Oktober Menschen verloren. Die Maschine hat es kaltherzig gemacht. Und das hat es einfacher gemacht.“
Maschinenmoral?
Dieser Gedankengang führt zu Ansätzen in der Maschinenethik, dass Künstliche Intelligenzen nicht nur Soldat*innen zu ethischen Entscheidungen verhelfen könnten, sondern dass unbemenschte KI-Systeme auch selbst dazu in der Lage seien, „auf dem Schlachtfeld in ethischerer Weise zu handeln als menschliche Soldaten (…). Sie werden sich in schwierigen Umständen menschlicher verhalten können als menschliche Wesen“, so der bekannte Robotiker und Pentagonberater Ronald C. Arkin.
Künstliche Intelligenz hat jedoch kein Gewissen. Und für Drohnenpilot*innen oder Soldat*innen in den Einsatzzentralen wird es immer schwerer, Gewissensentscheidungen auf Basis von KI-gestützten Systemen zu treffen, verschärft durch die ihnen sehr wohl bekannte Auswertungs(un)genauigkeit dieser Systeme. Sie sind ständig mit (Un-)Fällen konfrontiert,
bei denen Zivilist*innen ums Leben kommen, so wie beispielsweise Zabet Amanullah, ein Wahlkämpfer, der 2011 durch eine US-Drohne „versehentlich“ getötet wurde, da die Drohnenpilot*innen „auf ein Mobiltelefon zielten“, dessen Telefonnummer, als die eines wichtigen Taliban-Anführers verzeichnet war.
War on error
Militärisch adäquate Entscheidungen zu treffen, auf Basis einer rasant steigenden Menge an zu verarbeitenden Bild-, Sensorund Aktordaten, kann im High-Tech-Krieg ohne jeweilige Vor-Interpretationen KI-gestützter Systeme nicht mehr gewährleistet werden. Aus dieser Notwendigkeit heraus wird die bekannte Fehleranfälligkeit dieser Systeme von Militärs häufig billigend in Kauf genommen.
Durch die Quantensprünge in der technologischen Entwicklung der letzten Jahre stoßen Soldat*innen in High-Tech-Gefechtsfeldern bei ihren Analysen der vorliegenden Masse an Informationen jedoch noch immer an ihre sinnlichen und geistigen Grenzen, wie schon vor 10-15 Jahren: „Als bei einem Hubschrauberangriff im Februar 2011 dreiundzwanzig Gäste einer afghanischen Hochzeit getötet wurden, konnten die in Nevada auf Knöpfe drückenden Bediener der Aufklärungsdrohne die Schuld für ihren Irrtum auf die Informationsüberflutung schieben (...) – sie verloren den Überblick, gerade weil sie auf die Bildschirme schauten. Zu den Opfern des Bombardements gehörten auch Kinder, aber das Bedienpersonal „hatte sie inmitten des Strudels von Daten übersehen (...).“
Was tun?
Da wir meist nicht im Detail wissen, wie unsere moderne technische Lebenswelt funktioniert, sondern nur, wie wir unser Verhalten jeweils anpassen müssen, damit technische Objekte ihre Funktionen erfüllen, sind wir mehr denn je darauf angewiesen, der Technik teils blind zu vertrauen. So geht es auch Soldat*innen, die durch diese Systeme nicht nur lebensalltägliche Entscheidungen treffen müssen,
sondern Entscheidungen über Leben und Tod. Bei Deep Learning, (also jenem KIForschungs- und Anwendungsbereich, den wir vor allem meinen, wenn wir von Künstlicher Intelligenz sprechen) können sich jedoch nicht einmal mehr die Designer*innen und Programmierer*innen selbst die inneren Funktions- und Verhaltensweisen dieser technischen Systeme erklären. Wem also vertrauen?
Die „Fehler“ die passieren, sind trotz großer Fortschritte der Technologie noch dieselben wie vor 15 Jahren und offensichtlich nicht auszumerzen. In diesem Wissen können Soldat*innen die Verantwortung für ihre Tötungsentscheidungen nicht an Maschinen und Systeme delegieren. Das muss auch technologiebegeisterten Militärs und Politiker*innen und nicht zuletzt der Zivilgesellschaft bewusst sein. Insofern treffen diese eine grundlegende ethische Entscheidung, nämlich den Befehl zum Einsatz der Systeme, wissend um die Folgen und Konsequenzen ihrer Handlungen.
Wir müssen uns als Zivilgesellschaft dagegen wehren, dass sich der Glaube festigt, es sei möglich, in einer technisch erzeugten Kriegswirklichkeit autonome, informierte und dabei auch ethische Entscheidungen treffen zu können. Es ist dringend erforderlich, zu prüfen, inwieweit Praktiken des Targeted Killing mit unterstützenden KI-Systemen wie Lavender als Kriegsverbrechen betrachtet werden müssen.
Dies ist eine Kurzversion der Stellungnahme, die das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF), der AK gegen bewaffnete Drohnen und die Informationsstelle Militarisierung (IMI) am 29.4.2024 veröffentlicht haben: ippnw.de/bit/lavender
Die Stellungnahme wurde u.a. von Susanne Grabenhorst, Christian Heck, Christoph Marischka und Rainer Rehak erarbeitet.

11
FRIEDEN
Flächenbrand mit atomarem
Eskalationspotential
Iran – Israel
Der außenpolitische Berater des obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei, Kamal Charrasi, hat am 9. Mai 2024 im Konflikt mit Israel mit einem neuen Kurs des staatlichen Atomprogramms gedroht. „Wir haben keinen Plan für die Herstellung von Atomwaffen, aber falls das zionistische Regime es wagen sollte, unsere Atomanlagen anzugreifen, dann sind wir gezwungen, unsere Nukleardoktrin zu revidieren“, sagte er gegenüber dem arabischen Nachrichtensender Aljazeera und iranischen Staatsmedien. Bisher hatte der Iran sich stets darauf berufen, dass das Land aus religiösen Gründen nicht nach Atomwaffen strebe. Charrasi war von 1997 bis 2009 iranischer Außenminister und davor iranischer UN-Botschafter in New York.
Nach dem iranischen Angriff auf Israel im April 2024 als Vergeltung für die Bombardierung des iranischen Konsulatsgebäudes in Damaskus drohte im Nahen Osten ein Flächenbrand mit atomarem Eskalationspotential. Ein Krieg gegen den Iran hätte katastrophale Folgen weit über die Region hinaus.
Nun rächt sich die Aufkündigung des Iran-Atomabkommen durch Präsident Donald Trump im Jahr 2018. Das Abkommen wurde drei Jahre zuvor zwischen Iran und den USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China geschlossen und verpflichtete den Iran, sein ziviles Atomprogramm zu beschränken und keine Atomwaffen zu bauen. Im Gegenzug wurden Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Das Atomabkommen war auch deshalb herausragend, weil sich in ihm die fünf Atommächte USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China auf ein gemeinsames Handeln zu Eindämmung der Proliferation im Nahen und Mittleren Osten verpflichtet hatten.
Trotz vielfacher Warnungen europäischer Regierungen, dass eine Aufkündigung des Abkommens den Weltfrieden gefährden
könnte, hatte der US-Präsident den einseitigen Ausstieg aus dem Abkommen erklärt. US-Expert*innen der Internationalen Atomenergiebehörde zufolge verfügt der Iran inzwischen über genug angereichertes Uran für mindestens drei Atombomben, wie die Washington Post berichtete. Sollte der Konflikt mit Israel weiter eskalieren, steigt das Risiko erheblich, dass das Land versuchen wird, verlorenes Abschreckungspotential über eigene Atombomben zu kompensieren, betont Azadeh Zamirirad von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Israel hat sein Atomwaffenpotential nie offiziell zugegeben, droht jedoch in Krisensituationen immer wieder, es könne Atomwaffen einsetzen. Zuletzt schlug im November 2023 der israelische Kulturerbe-Minister Amichai Elijahu vor, eine Atombombe auf Gaza abzuwerfen! Expert*innen schätzen, dass Israel bis zu 90 Atomwaffen besitzt.
Die israelische Regierung hat in der Vergangenheit mehrfach Atomanlagen im Nahen Osten zerstört. 1981 bombardierte Israel den von Frankreich gebauten Kernreaktor Tammuz-1 im Osten Iraks. Die Brennelemente waren gerade angeliefert. Am 6. September 2007 flogen acht Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe einen Angriff auf den al-Kibar-Reaktor im Nordosten von Syrien und zerstörten ihn.
Neben dem Atomwaffenstaat Israel und Iran haben auch SaudiArabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei immer wieder atomare Ambitionen gezeigt. Zivile Atomprogramme werden offensiv vorangetrieben, um sich durch den Aufbau einer atomaren Infrastruktur den Griff auf die Bombe zu ermöglichen. Im Jahr 2018 verkündete Kronprinz Mohammed bin Salman und heutiger Premierminister Saudi-Arabiens beispielsweise: „Wenn der Iran eine Atombombe besitzt, so werden wir so schnell wie möglich ebenfalls eine Atombombe entwickeln.“
12
ATOMWAFFEN
Mögliche Mitgliedsstaaten einer Massenvernichtungswaffenfreien Zone im Nahen Osten

Sudan
Gebiete
Jordanien
Saudi-Arabien
Mitglied von Nichtverbreitungsvertrag, Biowaffen- und Chemiewaffenkonvention
Mitglied von Nichtverbreitungsvertrag, nicht jedoch von Biowaffen- und Chemiewaffenkonvention
Nicht Mitglied von NVV, Biowaffen- oder Chemiewaffenkonvention, hat Atomwaffen entwickelt
Iran sein Atomprogramm fortsetze. Es ist aber eine Illusion zu glauben, Israel könne das iranische Atomprogramm mittels Bombenangriffen, etwa auf die unterirdisch gelegene Urananreicherungsanlage in Natanz, zerstören. Allerdings wird in israelischen Geheimdienstkreisen durchaus erwogen, bunkerbrechende Waffen aus US-Produktion gegen iranische Atomanlagen einzusetzen. Ein solcher Angriff mit großen Zerstörungen und vielen zivilen Toten würde unweigerlich in einen offenen Krieg führen.
Wie lässt sich der brandgefährliche Konflikt zwischen Israel und dem Iran entschärfen? Die internationale Gemeinschaft ist aufgerufen, alle Seiten zur Deeskalation zu mahnen. Zusätzlich brauchen wir dringend einen Waffenstillstand in Gaza, eine Lösung für die katastrophale humanitäre Situation für die hungernde Bevölkerung im Gazastreifen sowie die Freilassung der israelischen Geiseln. Die USA und die Europäische Union müssen den Druck auf die Regierung Netanjahu für einen Waffenstillstand erhöhen. Dazu gehört der Stopp der Waffenlieferungen an Israel, den die IPPNW zusammen mit mehr als 250 Nichtregierungsorganisationen fordert. Es ist sehr zu begrüßen, dass die UN-Vollversammlung am 10. Mai 2024 die Rolle der Palästinenser*innen deutlich gestärkt hat. Sie nahm mit großer Mehrheit eine Resolution an, die es den Palästinenser*innen künftig erlaubt, sich in der UN-Vollversammlung ähnlich wie normale Mitglieder zu verhalten. Für die Resolution stimmten 143 Länder, 9 Staaten dagegen. 25 Länder enthielten sich – darunter auch Deutschland.
Die IPPNW fordert zudem, dass die Bundesregierung und die anderen EU-Staaten die Idee einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten vorantreiben, angelehnt an das Vorbild der KSZE. Ein mittel- und langfristiges zentrales Ziel solle darin bestehen, die Schaffung einer atomwaffen- bzw. massenvernichtungswaffenfreien Zone im Mittleren und
könnte zudem die Beziehung zwischen Iran und Israel sowie Iran und Saudi-Arabien umfassen als auch konkrete Verhandlungen zu Infrastrukturprojekten, Energiekooperationen und Umweltschutz. Die Idee für diese Konferenz hat 2018 UN-Generalsekretär António Guterres aufgegriffen.
Die Abrüstung und Ächtung von Massenvernichtungswaffen stellt einen wichtigen Teil dieses Projekts dar. Im November 2019 führten die UN eine Konferenz für den Aufbau einer massenvernichtungswaffenfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten durch, an der sich 23 Staaten beteiligten. Leider boykottierten die USA und Israel die Konferenz. Die teilnehmenden Staaten verpflichteten sich zur Ausarbeitung eines verbindlichen Vertrages zur Ächtung von Massenvernichtungswaffen. Dieser sollte Vertrauen zwischen den Konfliktparteien aufbauen und die Region vor einem atomaren Wettrüsten bewahren.
Langfristig müssen Atomwaffen völkerrechtlich verboten werden. Solange atomare Abschreckung Teil nationaler Sicherheitsdoktrinen ist, besteht die Gefahr ihres Einsatzes. Der Atomwaffenverbotsvertrag, der 2017 beschlossen wurde und den bereits 70 Staaten ratifiziert haben, ist der realistischste Weg zu einer koordinierten Abschaffung aller Atomwaffen. Angesichts der drohenden weltweiten atomaren Aufrüstung liegen diese diplomatischen Lösungen im Interesse aller Staaten – auch der Atomwaffenstaaten.
Dr. Angelika Claußen ist Co-Vorsitzende der deutschen IPPNW. Angelika Wilmen IPPNWReferentin für Frieden.


13
Iran Irak
Türkei
Afghanistan Pakistan
Oman
Katar Bahrain
Syrien
Turkmenistan
Jemen
V.A.E.
Kuwait
Palästinensische
Ägypten
Zypern Libanon Israel
© 2012 ETH Zürich / CSS Analysis No. 107 / Karte abgeändert
„We are survivors, but we still want a joyful life and happiness.“
Zu Besuch in Semei: Bericht von der ICAN-Bildungsreise nach Kasachstan
Unser Tag startete mit einem Treffen mit Überlebenden der ersten Generation. Sie erzählten uns, dass sie alle drei in Semei oder Umgebung, in der Nähe des Atomwaffentestareals, lebten. Dmitry erzählte von seinen Krankheiten, die er aufgrund der radioaktiven Strahlung hat. So alltägliche Dinge wie das Halten einer Kaffeetasse können schon ein Problem für ihn sein. Die jüngste Person, die als Betroffene der Atomwaffentests registriert wurde, ist 34 Jahre alt. Das spiegelt zwar sicherlich nicht die Realität wieder, zeigt aber, dass die Tests massive Auswirkungen auf die zweite, dritte, vierte und sogar fünfte Generationen haben.
Wir sprachen an diesem Tag nur mit betroffenen Männern, weshalb Maira Abenova von der Organisation Polygon21 noch einmal betonte, das die gesundheitlichen Folgen auf Frauen sich von denen auf Männern unterscheiden. Jede Frau hat, wenn sie schwanger wird, Angst davor, dass ihr Kind womöglich von den Folgen der Atomwaffentests betroffen sein wird. Es braucht auch in diesem Bereich mehr Forschung, damit das Stigma gegenüber Menschen aus der Region des Testgeländes abgebaut wird. Manche Menschen erhalten beispielsweise keine medizinische Versorgung, da die Ärtz*innen nicht wissen, welche Krankheiten sie haben.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Leute aus der betroffenen Region während der sowjetischen Zeit der Atomwaffentests nicht das Recht hatten, dazu Fragen zu stellen. Daher stellen viele Menschen auch heute keine Fragen dazu an ihre Regierung. Stattdessen beten sie, dass sie oder ihre Familie nicht krank werden. Zudem haben viele Menschen Angst vor Autoritäten und davor, kritische Fragen zu stellen. Für die Überlebenden und Betroffenen sind diese Geschichten nicht einmal tragische Geschichten, sondern ihre „normale“ Geschichte. Bei einigen

der Überlebenden hat eine gewisse Resignation eingesetzt, denn es interessieren sich immer wieder Menschen aus dem Ausland für ihre Geschichten, aber sie sehen selten, dass diese Besuche zu tatsächlichen Ergebnissen führen. Es gibt in diesem Bereich einige offene Fragen, deren Antworten für alle Betroffenen wichtig wären: Wie viele Überlebende gibt es insgesamt? Wie können sie beweisen, dass ihre Krankheiten mit den Atomwaffentests in Verbindung stehen? Wie sieht die aktuelle medizinische Forschung dazu aus?
Einen Teil der Fragen konnten wir zu unserem Treffen mit dem medizinischen Forschungsinstitut der Universität Semei mitnehmen. Dort wurden den persönlichen Geschichten Zahlen und Fakten gegenübergestellt. Die wissenschaftliche Direktorin Alexandra Lipikhina klärte uns über die Fakten des Testgeländes auf: Zwischen 1949 und 1989 fanden in Semipalatinsk über 465 Atomwaffentests statt. In dem heutigen Forschungsinstitut werden betroffene Menschen behandelt und vor allem registriert. Das „State Scientific Automated Medical Register“ ist das Registrierungssystem, in dem bereits 373.686 Menschen von der ersten bis zur fünften Generation registriert wurden. Auf dieser Grundlage werden alle Forschungen getätigt. Es wird
allerdings geschätzt, dass die Gesamtzahl aller Menschen, die von den Tests betroffen sind, bei 1,5 Millionen liegt! Der Grad der Betroffenheit unterscheidet sich auch, je nachdem, ob die Menschen die atmosphärischen Tests, die bis 1963 durchgeführt wurden, erleben mussten oder die späteren Untergrundtests.
Auf unserer Bildungsreise zur nuklearen Geschichte Kasachstans haben wir im Mai 2024 Astana, Semei (ehemals Semipalatinsk) und Almaty besucht. Wir reisten mit unseren Partner*innen der kasachischen Jugendorganisation STOP (Steppe Organization for Peace: Qazaq Youth Initiative for Nuclear Justice) und der Friedrich Ebert Stiftung Kasachstan. In Astana und Semei wurden wir von Maira Abenova begleitet. Sie ist Überlebende der sowjetischen Atomtests und gründete die Organisation Polygon21, die für die Rechte der Betroffenen kämpft. Alle Reiseberichte unter: nuclearban.de/survivors/kasachstan
Annegret Krüger arbeitet für das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn und ist im Vorstand des Frauennetzwerks für Frieden.

14
ATOMWAFFEN
Foto: Bennet Rietdorf
Semipalatinsk
Im heutigen Semei (Kasachstan) waren die Menschen jahrzehntelang der Radioaktivität von Atomtests ausgesetzt
Hintergrund
1949 führte die Sowjetunion ihren ersten Atomwaffentest in Semipalatinsk durch, einem 19.000 m² großen Testareal in der Steppe Kasachstans. Über einen Zeitraum von 40 Jahren detonierte die UdSSR 465 Atombomben in Semipalatinsk – stets ohne Rücksicht auf die Gesundheit und Sicherheit der Lokalbevölkerung oder der Umwelt. Nach der Unabhängigkeit Kasachstans im Jahr 1991 ließ die kasachische Regierung das Testgelände schließen und verschrottete das viertgrößte Atomwaffenarsenal der Welt, das sie als Erbe der UdSSR übernommen hatte.
Folgen für Umwelt und Gesundheit
Seit der Schließung des Testareals wurden verschiedene Studien durchgeführt, um die medizinischen, sozialen und ökologischen Folgen der radioaktiven Verseuchung der Region zu untersuchen. Obwohl die wissenschaftliche Aufarbeitung noch lange nicht abgeschlossen ist, besteht weitgehendes Einvernehmen darüber, dass die Lokalbevölkerung durch die Atomwaffentests großem Leid ausgesetzt wurde. Mehrere Tausend Quadratkilometer sind

für viele Generationen kontaminiert. Eine Reihe Gesundheitsprobleme, von Krebserkrankungen, Impotenz und Fehlgeburten bis hin zu genetischen Schäden und Missbildungen sowie geistiger Behinderung werden auf die Atomwaffentests zurückgeführt. Neben einer epidemieartigen Zunahme schwerer neurologischer Fehlbildungen, fehlender Gliedmaßen und Knochendeformitäten bei Neugeborenen fielen in Semipalatinsk auch erhöhte Raten von hämatologischen Erkrankungen wie Leukämie auf. Eine Studie japanischer und kasachischer Ärzte aus dem Jahr 2008 konnte zeigen, dass die Menschen in der Region rund um Semipalatinsk durch einzelne Atomexplosionen Strahlenwerten von mehr als 500 mSv ausgesetzt waren – also ähnlichen Werten wie viele der Hibakusha von Hiroshima und Nagasaki – oder dem Äquivalent von 25.000 Röntgenuntersuchungen.
Das Krebszentrum der Stadt Semei stellte stark erhöhte Häufungen von Tumoren der Lunge, des Magens, der Brust und der Schilddrüse in der betroffenen Bevölkerung fest. Das kasachische Institut für Strahlenmedizin und Ökologie fand derweil eine belastbare Assoziation zwischen der Höhe der Strahlenbelastung und dem Auftreten genetischer Defekte in Familien, die in der Umgebung der Testgebiete lebten. Untersuchungen der Universität von Leicester konnten diese Beobachtungen stützen: Die britischen Wissenschaftler fanden im Jahr 2002 eine um 80 % erhöhte Rate an DNA-Mutationen in der betroffenen Bevölkerung sowie eine 50 %-Erhöhung in der zweiten Generation.
Ausblick
2009 verabschiedete die Generalvollversammlung der UN einstimmig eine Resolution, in der die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert wird, Kasachstan bei der Aufarbeitung der schwerwiegenden Folgen der Atomwaffentests in Semipalatinsk zu unterstützen. Mehrere UN-Organisationen, Geldgeber, Nichtregierungsorganisationen sowie medizinische und wissenschaftliche Einrichtungen haben sich seitdem zusammengefunden, um gemeinsam das atomare Erbe der sowjetischen Atomwaffentests in Kasachstan zu untersuchen und die Folgen für die Hibakusha von Semipalatinsk zu mildern. Der 29. August, der Tag, an dem das Atomwaffentestgelände Semipalatinsk 1991 geschlossen wurde, ist heute der Internationale Tag gegen Atomtests.
Dieser Text ist ein Ausschnitt aus der IPPNW-Posterausstellung „Hibakusha Weltweit“. Die Ausstellung zeigt die Zusammenhänge der unterschiedlichen Aspekte der Nuklearen Kette: vom Uranbergbau über die Urananreicherung, zivile Atomunglücke, Atomfabriken, Atomwaffentests, militärische Atomunfälle, Atombombenangriffe bis hin zum Atommüll und abgereicherter Uranmunition. Sie kann ausgeliehen werden. Weitere Infos unter: www.hibakusha-weltweit.de
15 DIE NUKLEARE KETTE
Gefährliche Atom-Fantasien
Warum die Pläne einer neuen Atom-Allianz nur Luftschlösser sind, aber dem Klima schaden
„Die Atomkraft ist zurück“, verkündet Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am 3. Dezember 2023 in Dubai. Ort und Zeitpunkt sind nicht zufällig gewählt.
Macron nutzt die Weltklimakonferenz (COP28) als Bühne für seinen Presseauftritt. Gerade haben 22 Staaten eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet, wonach sie die globalen Kapazitäten des Atomenergiesektors bis 2050 verdreifachen wollen. Auch wenn die Erklärung rechtlich keine Bedeutung hat und die Atomindustrie aktuell weit davon entfernt ist, auch nur bestehende Kapazitäten zu erhalten, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit ist Macron auf der COP28 gewiss. Die Nachricht von der Rückkehr der Atomenergie geht um die Welt.
Wenige Monate später, im März 2024, folgt der nächste medienwirksame Auftritt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) veranstaltet in Brüssel den ersten Atomgipfel. Das Ganze ist eine große Werbeveranstaltung, die Atomkraft als Heilmittel gegen Klimawandel verkauft. „Atoms for Net Zero“ nennt die IAEA ihre Kampagne, mit der sie die Atomindustrie wiederbeleben will. Sie wirkt. Rund 30 Staaten verpflichten sich im Zuge des Gipfels, sich gemeinsam dafür einzusetzen, „das Potenzial der Nuklearenergie voll auszuschöpfen“. Dabei gehe es nicht nur darum, neue Atomkraftwerke zu bauen, sondern auch Laufzeitverlängerungen für alte Reaktoren zu erwirken. Dies sei der Weg zu Klimaschutz und Energieunabhängigkeit, so das Versprechen. Zugleich fordert die neue Atom-Allianz die Weltbank auf, Atomprojekte verstärkt zu unterstützen und re-
klamiert, die Entwicklungsbanken würden „andere alternative Energieträger“ bislang bevorzugt behandeln. Die vorsichtigen Formulierungen sind alles andere als harmlos. Sie zielen auf öffentliche Klimaschutzgelder ab und sind somit eine direkte Kampfansage an die Erneuerbaren Energien.
AKWs laufen nur mit Subventionen
Wie so oft, geht es um Geld. Die Atomindustrie braucht viel davon. Schließlich betreibt sie die teuerste Form der Energieerzeugung. Der Neubau eines Atomkraftwerkes kostet im internationalen Durchschnitt etwa zehn Milliarden Euro. Die Schätzungen für Instandhaltungskosten im Zuge von Laufzeitverlängerungen reichen von hunderten Millionen Euros bis zu mehreren Milliarden. Vor dem Hintergrund, dass das Durchschnittsalter der weltweiten Reaktorflotte bei 31,5 Jahren liegt, braucht die Atomindustrie enorm hohe Investitionssummen, will sie den Sektor am Leben halten. Dafür kommen in erster Linie öffentliche Gelder infrage. Denn Finanzunternehmen wie etwa die weltweit größte Finanz-Ratingagentur Standard & Poor‘s warnen private Anleger*innen vor Investitionen in Atomkraft. AKW-Projekte lohnen sich seit jeher nur, wenn Staaten dahinter stehen, die das Ganze mit Steuergeldern und vollen Händen subventionieren.
Die IAEA ist eine Werbeagentur für Atomkraft
Mit Klimaschutz hat die „Atoms for Net Zero“-Initiative der IAEA nichts zu tun. Die Atomenergiebehörde, die eine Einrichtung der Vereinten Nationen ist, folgt lediglich ihren Grundstatuten, wonach sie neben ihren Überwachungs- und Inspektionsaufgaben verpflichtet ist, die weltweite Verbreitung der Atomenergie zu fördern. Die
Behauptung, Atomenergie sei klimafreundlich, beruht dabei lediglich auf dem Argument, dass AKW-Schornsteine keine CO2Emissionen ausstoßen. Diese Betrachtung greift nicht allein deshalb zu kurz, weil Atomkraftwerke in ihrem Lebenszyklus deutlich höhere Emissionen verursachen als erneuerbare Energien. Vielmehr geht es auch um eine realistische Einschätzung des Potenzials. Aktuell liegt der Anteil des Nuklearsektors an der globalen Stromerzeugung bei unter zehn Prozent. Bezogen auf die weltweite Netto-Energiemenge macht Atomkraft nur einen Bruchteil von etwa zwei Prozent aus. Das heißt, Atomenergie hat global betrachtet weder eine Relevanz für die Energieversorgung noch für den Klimaschutz. Sie ist eine Nischentechnologie, die noch dazu schrumpft, wie unter anderem die jährlichen Statistiken und Analysen des World Nuclear Industry Status Reports aufzeigen.
Atomkraft gefährdet den Klimaschutz
Die Vorstellung, die Atomindustrie könnte ihre Kapazitäten innerhalb der nächsten 26 Jahre verdreifachen, ist eine gefährliche Illusion. Denn sie stellt sich in Konkurrenz zu den erneuerbaren Energien und dem notwendigen Umbau unseres Energiesystems. Dabei droht sie zwei wichtige Ressourcen zu verschwenden, die im Kampf gegen den Klimawandel begrenzt zur Verfügung stehen: Zeit und Geld.
Gelder, die in den Erhalt und in den Ausbau der nuklearen Energiekapazitäten fließen, fehlen für die Transformation des Energiesektors. Das betrifft auch die Milliardensummen, die Staaten in die Erforschung vermeintlich neuer Reaktorkonzepte und in die Kernfusion stecken. Bei den „neuen“ Reaktortypen handelt es sich
16
ATOMENERGIE

um Technologie-Linien, die bereits in den 1950er Jahren erforscht, entwickelt und aus technischen Gründen wieder verworfen wurden. Sollten sie überhaupt jemals Serienreife erlangen, für den Klimaschutz kämen sie zu spät. Ebenfalls ist keine der diskutierten Reaktortechniken in der Lage, das Atommüllproblem zu lösen, auch wenn das über die Medien bis in den Bundestag hinein kolportiert wird. Wenn von AKW-Neubau-Projekten die Rede ist, handelt es sich in erster Linie um die herkömmliche Druckwasser-Reaktortechnik mit allen bekannten Folgen und Sicherheitsrisiken. Planung und Bau eines Atomreaktors dauern durchschnittlich 20 Jahre. Autokratische Staaten wie China oder Russland setzten AKW-Projekte schneller um – dafür verzichten sie auf demokratische Prozesse und machen Abstriche bei der Sicherheit.
Grundsätzlich sind AKW-Bauprojekte mit hohen Risiken verbunden. So ist der einzige Reaktor-Neubau, den das Atomland Frankreich in den letzten Jahrzehnten gebaut hat, bereits seit zwölf Jahren in Verzug. Die Kosten sind gegenüber der ursprünglichen Planung um etwa zehn Milliarden Euro gestiegen. In Großbritannien ist die Situation ähnlich. Die einzige Anlage in Bau, Hinkley Point C, ist ein Desaster. Kostenexplosionen und extremer Zeitverzug sind beim Bau von Atomkraftwerken keine Ausnahme, sondern die Regel. Auch Laufzeitverlängerungen sind mit Unsicherheiten verbunden; sie sind zudem ein großes Sicherheitsrisiko, da der Reaktorkern, der enormen Belastungen ausgesetzt ist, nicht austauschbar ist.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Initiative der Atom-Allianz wie Realitätsverweigerung. Sie dient jedoch dem Versuch, Klimaschutzgelder in die Atomkanäle um-


zuleiten, um eine überlebte Technik zu retten. Dennoch verfangen die leeren Versprechen in der Öffentlichkeit und in der Politik. Denn sie suggerieren, mit Atomkraft seien unsere Energieprobleme in Zukunft gelöst. Das mag einfacher klingen als Veränderung – es ist aber eine Lüge.
Klimaschutz geht anders
Zahlreiche wissenschaftliche Studien und Analysen zeigen, dass es machbar und sinnvoll ist, den Energiebedarf auch eines Industrielandes wie Deutschland zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu decken. Der Umbau des Energiesektors ist komplex und bedarf neben dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen und der Erweiterung von Speicherkapazitäten auch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und -suffizienz. All dies lässt sich auf die Kilowattstunde gerechnet um ein Vielfaches schneller und kostengünstiger umsetzen als der Bau von Atomkraftwerken. Von Energieunabhängigkeit kann im
Zusammenhang mit Atomkraft ebenfalls nicht die Rede sein. So haben die USA und die EU für den Nuklearsektor bislang keine Sanktionen gegen Russland verhängt, weil sie von dessen Urangeschäften abhängig sind. Auch ohne den Verweis auf das ungelöste Atommüllproblem und die untragbaren Sicherheitsrisiken ist Atomkraft weder Zukunfts- noch Brückentechnologie.
Angela Wolff ist Referentin für Atompolitik und Klimaschutz.

17
© Eric de Mildt / Greenpeace IPPNW Aachen PROTEST GEGEN DEN IAEA-ATOMGIPFEL IN BRÜSSEL, 21.03.2024
Aus der Psychiatrie in den Abschiebeflieger
Für psychisch Kranke ist es kaum noch möglich, ein krankheitsbezogenes Abschiebungshindernis nachzuweisen
Imad wurde trotz akuter Suizidalität abgeschoben – in ein Land, in dem er seit 15 Jahren nicht mehr war.
„Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“, sagt Imad (Name geändert) am Telefon. Im Hintergrund ist das Zwitschern eines Vogels zu hören. Der 29-jährige Jeside wurde am 18. Januar 2024 von GarmischPartenkirchen in den Irak abgeschoben. Ich spreche mit ihm vermittelt über seine langjährige Freundin Anna, die ihm nachgereist ist. Zur Zeit seiner Abschiebung befand sich Imad wegen Suizidgefahr in der Psychiatrie und war auf Medikamente angewiesen. „Wir vermuten, dass die Klinik informiert war“, sagt Anna. Denn am Tag, bevor die Polizei ihn abholen kam, sei er von einem Mehrbett- in ein Einzelzimmer verlegt worden.
„Krankenhäuser müssen geschützte Räume sein“, davon ist Ernst-Ludwig Iskenius (IPPNW) überzeugt. Er hat das Zentrum für traumatisierte Geflüchtete in VillingenSchwenningen aufgebaut und 15 Jahre in dem Bereich gearbeitet.
Abschiebungen aus stationärer Behandlung sind stets unverhältnismäßig
Der Deutsche Ärztetag bekräftigte zuletzt 2017, dass stationär behandlungsbedürftige Flüchtlinge nicht reisefähig sind und dementsprechend nicht abgeschoben werden dürfen. Und auch das Institut für Menschenrechte kam in einer Studie von 2021 zu dem Schluss, dass eine Abschiebung aus der stationären Behandlung stets unverhältnismäßig sei. Trotzdem kommt das immer wieder vor – und die Ausländerbehörden und die Polizei bewegen sich damit innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Nur in Berlin, Brandenburg, Bremen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein gibt es Erlasse, die
Abschiebungen aus Krankenhäusern verbieten oder zumindest einschränken. „Die Behörden nehmen einen Suizidversuch oft nicht ernst. Sie behaupten, die Person wolle damit nur die Abschiebung verhindern“, sagt Iskenius. Für ihn ist das ein Systemfehler: „Oft wird eine Traumatisierung von Geflüchteten gar nicht offiziell festgestellt und bleibt unbehandelt. In einer Abschiebesituation bricht das dann auf“, erklärt er.
Die Länder erheben nur vereinzelt Zahlen über Abschiebungen aus stationärer Behandlung. Darum hat IPPNW im Dezember vergangenen Jahres mit „Behandeln statt verwalten“ die erste bundesweite Meldestelle eingerichtet. Fünf Fälle wurden seitdem von Monitoringstellen und Einzelpersonen dort gemeldet. Imad ist einer von ihnen. Wie er seien es oft Menschen mit psychischen Erkrankungen und Traumata in Duldung, die von einer Abschiebung aus dem Krankenhaus betroffen seien, sagt Iskenius. Aus seiner Sicht ist die Abschiebung ein schwerer Eingriff in die medizinische Behandlung. „Bei Vorgeschädigten kann das zu schweren Retraumatisierungen führen“, sagt Iskenius.
Abschiebungen von Jesid*innen nehmen zu
Imad lebte seit seinem 15. Lebensjahr in Deutschland. Er hat 2008 den Irak verlassen, sein Vater war im Irakkrieg für USamerikanisches und deutsches Militär tätig, die Familie erhielt Morddrohungen, so erzählt es Anna.
Genau einen Tag nach seiner Abschiebung jährte sich der Tag, an dem die Bundesregierung den Genozid an den Jesid*innen durch den IS anerkannt hatte. Noch im März vergangenen Jahres hieß es seitens der Bundesregierung, es sei für jesidische Religionszugehörige aus dem Irak „ungeachtet veränderter Verhältnisse nicht zumutbar, in den früheren Verfolgerstaat zurückzukehren“. Doch
Abschiebungen von Jesid*innen neben schon seit 2017 zu, die Schutzquote liegt bei rund 50 Prozent. 2023 wurden laut Bundesinnenministerium 135 Menschen in den Irak abgeschoben, wie viele Jesid*innen darunter waren, sei unbekannt.
Laut dem Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, dessen Ausländerbehörde Imad zugeordnet war, wurden zu Imad zwei Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgeschlossen, ohne dass ihm ein Schutzstatus zuerkannt wurde. Die Ausweisungsverfügung sei wegen einer schweren Straftat erlassen worden. Deshalb sei auch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen gewesen.
Für Imad ist das unverständlich, die Straftat liegt rund acht Jahre zurück, seit fünf Jahren ist er in Garmisch-Partenkirchen geduldet. Zuletzt hatte er eine Ausbildung zum Friseur abgeschlossen. Doch erst wenige Monate vor seiner Abschiebung habe er eine Arbeitserlaubnis erhalten. Eine Arbeit zu finden sei schwer, erzählt Anna. Imad habe seit langem psychische Probleme gehabt und mehrere Suizidversuche unternommen, mehrmals sei er für drei bis vier Wochen stationär aufgenommen worden. Sein Psychiater hatte aus gesundheitlichen Gründen den Umzug zu seiner Familie in München empfohlen, wegen der Residenzpflicht brauchte Imad dafür eine behördliche Erlaubnis.
Nachweispflicht für Abschiebungshindernis liegt bei den Schutzsuchenden
Am 3. Januar 2024 sei er dann nachts bei seiner Verlobten von der Polizei festgenommen worden, er habe eine Nacht in Haft verbracht. Danach hätte er in ein Abschiebegefängnis überführt werden sollen. Doch das Amtsgericht hob den Haftbefehl am nächsten Tag auf, weil es die gesundheitlichen Beeinträchtigungen Imads für „nicht unplausibel“ hielt. Der
18
SOZIALE VERANTWORTUNG
Richter regte an, ein behördliches Gesundheitsgutachten anfertigen zu lassen, um ein Abschiebehindernis zu klären. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen folgte dieser Empfehlung jedoch nicht und forderte Imad auf, sich selbst darum zu kümmern. „Die Nachweispflicht der Reiseunfähigkeit liegt bei der Person. Sofern diese nicht oder nicht ausreichend nachgewiesen wird, ist immer von einer Reisefähigkeit auszugehen und eine Abschiebung ist möglich“, lässt das Landratsamt mitteilen. So ist es im Aufenthaltsgesetz festgeschrieben (§ 60 Absatz 2c). Im Fall von Imad seien die vorgelegten medizinischen Unterlagen nicht geeignet gewesen, „die gesetzliche Vermutung der Reisefähigkeit anzuzweifeln“, so das Landratsamt weiter. Und: Man habe sich die Reisefähigkeit ärztlich bestätigen lassen.
„In den letzten Jahren hat die Bundesregierung die Anforderungen zum Nachweis einer Erkrankung derart verschärft, dass es insbesondere für psychisch Kranke kaum noch möglich ist, ein krankheitsbezogenes Abschiebungshindernis nachzuweisen“, kritisiert Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Sie setzt sich dafür ein, die Nachweispflicht auf die Behörden zu verlagern. „Wenn eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben besteht, bei psychisch Erkrankten beispielsweise bei einer akuten Suizidgefahr, darf die Verantwortung für die Nachweise nicht bei den Betroffenen liegen.“ Die aktuelle Regelung hält sie für verfassungswidrig.
Anna schildert, wie schwer es für Imad war, seinen gesundheitlichen Zustand nachzuweisen. Aufgrund der nächtlichen Festnahme durch die Polizei und die Zeit in der Zelle habe sich sein Zustand verschlechtert, Panikattacken und Suizidgedanken hätten zugenommen. Seinen Psychiater habe er nicht erreichen können. Am 15. Januar 2024 ließ er sich in die Psychiatrie einweisen.
Für die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BafF) ist allein die stationäre Behandlung ein Anhaltspunkt: „Um derart psychisch belastet zu sein, dass eine ambulante Versorgung nicht mehr

greifen kann, haben Menschen in der Regel bereits mehrere größere psychische Krisen, darunter auch schwere traumatische Erfahrungen, durchleben müssen“, heißt es auf der Website.
Der Eilantrag scheiterte
Drei Tage nach der Einweisung wurde Imad in der Psychiatrie von der Polizei festgenommen und zum Leipziger Flughafen gebracht. Erst eineinhalb Stunden vor dem Flug sei ihm gestattet worden, zu telefonieren. Ein dann gestellter Eilantrag scheiterte, weil er zu dem Zeitpunkt schon im Flugzeug saß, erzählt Anna. Der Gesundheitszustand ihres Freundes sei schlecht: „Er hat Entzugserscheinungen, kann nicht schlafen, isoliert sich und verlässt aus Angst nicht das Haus“, sagt Anna. Nachts habe er Angst, dass er wieder abgeholt werde. Sie sei ihm nachgereist, um ihm seine Papiere und Geld zu bringen, Medikamente kann sie nicht so einfach mitführen. Die Polizei habe ihn ohne gültige Ausweispapiere, Geld und Medikamente abgeschoben.
Das alles liege nicht in der Verantwortung der Behörde, heißt es aus Garmisch-Partenkirchen. Am Flughafen in Bagdad sei er behördlich registriert worden, medizinisches Personal sei – anders als es die deutsche Ausländerbehörde sagt – nicht vor Ort gewesen. Ohne die Hilfe seiner Familie und seiner Freundin wäre Imad jetzt krank, ohne Geld, Papiere und Medikamente in einer fremden Stadt, in einem Land, in dem er seit 15 Jahren nicht mehr
war. „Ich bin krank, mein Vater in München ist krank. Ich möchte einfach nur bei meiner Familie sein“, sagt Imad.
Iskenius fürchtet, dass es durch das verschärfte Abschiebegesetz noch vermehrt zu Abschiebungen von kranken Menschen kommen könnte. Ihm liegt deshalb viel daran, das medizinische Personal zu informieren und zu ermutigen, sich gegenüber Behörden, Amtspersonen und Polizei für das Wohl der Patient*innen einzusetzen. Auf der Website der Meldestelle finden sich Handreichungen dazu.
„Ärzte haben im Krankenhaus das Hausrecht. Wenn die Polizei keinen Durchsuchungsbeschluss hat, darf sie das Krankenzimmer nicht einfach betreten“, sagt Iskenius. Außerdem unterliegen Ärzt*innen der Schweigepflicht und könnten daher die Auskunft verweigern. Eine weitere Möglichkeit sei, zu prüfen, ob akut ein „krankheitsbedingtes Abschiebungshindernis“ vorliegt. Für diesen Fall dürfe die Abschiebungsanordnung nicht vollzogen werden.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des HIV-Magazins: magazin.hiv
Ulrike Wagener ist freie Journalistin und arbeitet schwerpunktmäßig zu den Themen Flucht und Migration, Gender und (Post-) Kolonialismus.

19
Saulo Zayas / pexels.com
Foto: Kathrin Sohlbach

Meine vier Kinder sind von zu Hause ausgezogen, so dass ich mich um acht Enkelkinder kümmern muss. Das älteste ist 15 und das jüngste ist drei Jahre alt.
Elizabeth Dube
Chembe/UNDP Zimbabwe
Pylaia
Bei UNDP Climate finden Sie Berichte über Klimaprojekte weltweit:

Klimaverträgliche Landwirtschaft stärkt Frauen in Simbabwe UNDP-climate.exposure.co
Bäuerinnen
im Aufwind
Die Bäuerin Elizabeth Dube (73) aus Matebeleland South bewässert ihre Ernte. Landbesitz und der Verkauf der Produkte war lange Männern vorbehalten, doch inzwischen besitzt Elizabeth eine kleine Ackerfläche. Seit letztem Jahr hat sie auch Zugang zu einer solarbetriebenen Bewässerungsanlage – ein entscheidender Vorteil in einer Region, die in Folge des Klimawandels immer trockener wird. Frauen sind von den Auswirkungen der Klimakrise besonders betroffen. Aufgrund von Geschlechterrollen sind sie meist verantwortlich, knapper werdende Ressourcen wie Wasser oder Feuerholz über weite Distanzen zu beschaffen, während ihr Zugang zu Informationen und Anpassungsstrategien erschwert wird. Hier setzen Graswurzelprojekte an, die Frauen in ihren Gemeinschaften stärken und die landwirtschaftliche Produktion an die Klimaveränderungen anpassen. Sie kombinieren gemeindebasierte technische Lösungen wie solarbetriebene Irrigation mit der Ausbildung von Multiplikatorinnen. Mehr als 45.000 Landwirtinnen haben ihr neues Wissen bereits in die Praxis umgesetzt und praktizieren nun einen konservierenden, „klimaintelligenten“ Anbau. Text und Bilder: UNDP Zimbabwe.



21
UNDP Zimbabwe / CC BY-NC 2.0 Deed UNDP Zimbabwe / CC BY-NC 2.0 Deed Pylaia Chembe/UNDP Zimbabwe
Kenia: Klima und Gesundheit
Ärztinnen und Ärzte werden aktiv für eine klimaresisente Gesundheitsversorgung
Die Auswirkungen des Klimawandels verschärfen sich und treffen insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Frauen und Kinder, Menschen mit Behinderungen, Geflüchtete und Asylsuchende, die einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind.
In diesem Artikel untersuchen wir die vielschichtigen Herausforderungen, die die Klimakrise für die öffentliche Gesundheit in Kenia mit sich bringt. Wir konzentrieren uns dabei auf die Anpassungsstrategien, die von Gesundheitskräften, dem Gesundheitssystem sowie mithilfe gemeinschaftsorientierter Kampagnen umgesetzt werden, um die Widerstandsfähigkeit vulnerabler Kommunen angesichts klimabedingter Katastrophen zu stärken.
Kenia erstreckt sich über eine Fläche von rund 582.646 km2 und hat derzeit 56 Millionen Einwohner. Das Land besteht im Wesentlichen aus der Küstenregion im Südosten, einer gemäßigten Region im Landesinneren, dem zentralen tropischen
Hochland und einer weitgehend trockenen und halbtrockenen Region im Norden. Durch seine Lage am Äquator ist Kenia sehr anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels – laut dem Klima-Risiko-Index 2020 gehört es zu den am stärksten gefährdeten Ländern. Allein im ersten Quartal 2024 erlebte Kenia nie dagewesene Temperaturspitzen, gefolgt von unregelmäßigen Niederschlägen im zweiten Quartal, die verheerende Dürren und Überschwemmungen auslösten.
Klimabedingte Risiken
Laut der Weltgesundheitsstatistik 2023 wird der Klimawandel derzeit als dringende Gefahr für die menschliche Gesund-
heit eingestuft. Nach den vorliegenden Erkenntnissen wirkt sich der Klimawandel wie folgt auf die Gesundheit aus:
» Direkte Sterblichkeit und Verletzungen durch klimabedingte Naturgefahren wie Überschwemmungen, Dürren, Küstenstürme wie der Zyklon Hidaya und extreme Hitzewellen.
» Indirekt durch vektorübertragene Krankheiten, die durch das Klima beeinflusst werden (wie Malaria, Dengue-Fieber, RiftValley-Fieber, Chikungunya-Fieber) durch wasserbezogene Krankheiten, Unterernährung und Ernährungsunsicherheit, Vertreibung und Migration sowie durch die Destabilisierung der Gesundheitsinfrastruktur.

KLIMAKRISE Foto: GOA
ÜBERFLUTUNGEN IN TANA RIVER COUNTY, KENIA. 228 MENSCHEN STARBEN IM FRÜHJAHR 2024 IN DEN FLUTEN.
Jüngste Studien zeigen mögliche Zusammenhänge zwischen den Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit, sogenannter „Klimaangst“, und der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. So etwa nehmen sexuelle Gewalt, „Transactional Sex“ (Sex für Gegenleistungen) und frühe Heiraten in Folge des Klimawandels zu.
Das Zusammentreffen von klimabedingten Katastrophen und konfliktbedingten Vertreibungen hat zu einer Massenmigration innerhalb und über die Grenzen Kenias hinaus geführt, die das vorhandene Gesundheitssystem überfordert. Der Norden Kenias ist aufgrund der schwindenden Land- und Wasserressourcen besonders von gewaltsamen Auseinandersetzungen betroffen.
In der Region am Horn von Afrika herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren, die zum Tod von Vieh im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr führt. Im Welthunger-Index 2023 nimmt Kenia den 90. Platz von 125 Ländern ein, für die ausreichende Daten vorliegen. Mit einem Wert von 22,0 fällt Kenia in die Schweregradkategorie „ernst“.
Klima-
und Gesundheitspolitik
Kenias dritter Aktionsplan zum Klimawandel (NCCAP 2023-27) baut auf den vorherigen Aktionsplänen auf und bietet einen Rahmen für Kenia, um seinen national festgelegten Beitrag zu leisten. Kenia hat wichtige Initiativen zur Entwicklung einer klimafreundlichen Programmplanung und präventiver Gesundheitsmaßnahmen eingeleitet, die auf einem risikoübergreifenden Frühwarn- und Frühaktionsansatz beruhen. Der erste Schritt zur Stärkung des Gesundheitssystems sind gemeinsame Anstrengungen aller Akteure des Gesundheitswesens, um ein kontinuierliches Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zu schaffen, und zwar durch eine wirksame

KLEINBAUERN UND NGOS DISKUTIEREN ÜBER KLIMARESILIENTE LANDWIRTSCHAFT
Kommunikation und die Weitergabe von Erkenntnissen an das wichtigste Gesundheitspersonal.
Verschiedene Gesundheitsorganisationen und die kenianische Regierung haben die Kapazitäten für eine integrierte Gesundheits- und Klimabeurteilung und Maßnahmen für besonders gefährdete Gruppen wie Frauen und Kinder, Menschen in informellen Siedlungen, Menschen mit Behinderungen sowie Geflüchtete und Asylsuchende ausgebaut. Regelmäßige Sensibilisierungskampagnen für Risikogruppen werden durchgeführt, um das Wissen über sanitäre Einrichtungen, Hygiene, klimasensitive Krankheiten sowie über Belange der sexuellen und reproduktive Gesundheit zu verbessern.
Wichtige Interessenvertreter*innen des Gesundheitssektors in Kenia fordern nun einen Platz im Dialog über die Klimafinanzierung, um sicherzustellen, dass angemessen in die Entwicklung klimaresistenter Infrastrukturen, Gesundheitssysteme und gemeindebasierter Anpassungsinitiativen investiert wird.
Der Gesundheitssektor beteiligt sich zunehmend an politischen Dialogen darüber wie wir uns an den Klimawandel anpassen und ihn abmildern können, um die Gesundheitsbedürfnisse der vom Klimawandel am stärksten gefährdeten Menschen in die Anpassungsprogramme zu integrieren. Darüber hinaus wird durch die Beteiligung am politischen Dialog sichergestellt, dass eine klimaresistente Gesundheitsinfrastruktur für den Fall extremer Wetterereignisse geschaffen wird.
Kenia hat Frühwarnsysteme zur Vorhersage klimasensibler, durch Mücken übertragener Krankheiten eingerichtet und damit das Epidemiepotential verringert. Diese Maßnahmen basieren auf Studien zu den monatlichen Durchschnittstemperaturen und Niederschlagsdaten – das Frühwarnsystem führt diese mit Daten zum Vorkommen von Überträgern in Haushalten zusammen sowie Daten von Patient*innen, die mit Krankheiten wie Malaria und Dengue-Fieber in Krankenhäusern behandelt wurden. Der Zusammenhang zwischen den Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit ist noch nicht ausreichend erforscht, und die Bemühungen, die psychische Gesundheit und die Stressbewältigung in alle Klimaund Gesundheitsprogramme zu integrieren, nehmen zu.
Dennis Opondo, Harrison Kuria Karime und Victor Chelashow sind Ärzte und Mitglieder IPPNW Kenia.



Foto:
Nawiri
23
Haki
Schwierige Zeiten für Klima- und Umweltschutz
Rollback in der Klimapolitik: Warum wir nicht angemessen handeln – und was trotzdem Hoffnung macht
Die Klimakrise ist eine ökologische Notlage und eine große Herausforderung für die globale Gesundheit. Sie droht inzwischen die gesundheitlichen Fortschritte der letzten 60 Jahre zunichte zu machen. Sie gefährdet die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, und führt dazu, dass immer größere Teile der Erde für Menschen und Lebewesen praktisch unbewohnbar werden. So ist Luftverschmutzung für sieben Millionen vorzeitige Todesfälle verantwortlich, deren Hauptursache die Nutzung fossiler Brennstoffe in Verkehr, Industrie und Landwirtschaft ist. Die Zahl der Hitzetoten sowie der Opfer von Extremwetterereignissen wird bei einem Weiter-so weltweit in die Millionen gehen. Die Gesundheitseinrichtungen werden mit dieser Entwicklung zunehmend überfordert sein.
Klima- und Umweltschutz sind Gesundheitsschutz. Klimaschutz als präventiver Ansatz ist zentral, um unsere Gesundheitssysteme auch in Zukunft bezahlbar und resilient zu machen. Diese Einsicht setzt sich allmählich durch. Viele Klimaschutzmaßnahmen gehen mit großen Vorteilen für die Gesundheit einher. Dies gilt vorrangig für Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung, die Umstellung auf eine pflanzenbasierte Ernährung sowie für eine klimafreundliche aktive Mobilität. Außerdem muss auch der Gesundheitssektor seinen Treibhausfußabdruck deutlich senken und perspektivisch klimaneutral werden.
Weshalb handeln wir angesichts dieser Lage nicht angemessen?
Die Lösungen liegen im Prinzip vor, doch geschieht nicht das, was notwendig und „vernünftig“ wäre. Die Ursachen sind komplex und vielfältig. Einige der wesentlichen seien hier aufgeführt:
Die „Fossilität“: eine Struktur, die tief in unserer Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur verankert ist, und einem erforderlichen Wandel entgegensteht (z.B. Lebensstile, Fliegen, autofreundliche Städte, unzureichender ÖPNV). Dazu zählt auch die Verquickung von Teilen der Politik mit fossilen Interessen. „Dass die erforderlichen Maßnahmen nicht ergriffen werden, liegt an der Beschaffenheit der Macht- und Anreizstrukturen für Unternehmen, Politiker, Wähler und Konsumenten“, so der Soziologe Jens Beckert. Dazu gehört der Glaube an ungebremstes Wachstum, das mit den planetaren Grenzen nicht vereinbar ist.
Der Einfluss von Big Oil: Die fossile Brennstoffindustrie hat uns seit Jahrzehnten belogen, die Klimawissenschaft diskreditiert, Zweifel gesät und „Thinktanks“ gegründet, die progressive Klimapolitik bekämpften. Sie hat per Lobbyismus und Bestechung auf die Politik eingewirkt, alle Maßnahmen, die ihr lukratives Geschäftsmodell gefährden könnten, zu unterlaufen. Konzerne und Petrostaaten versuchen immer noch, alles zu verhindern oder zu verwässern, was zu einer schnellen Abkehr von den Fossilen führen würde.
Das Versagen der Medien: Die Medien haben es über Jahrzehnte versäumt, über die sich abzeichnende Megakrise angemessen, faktenorientiert und nicht verzerrt zu berichten. Das hängt u.a. mit den Verflechtungen zwischen fossilen Kapitalinteressen und Medienkonzernen zusammen, wie etwa das Murdoch-Imperium oder der Axel-Springer-Konzern zeigen.
Schwierigkeiten des transformativen Wandels angesichts komplexer Probleme: Grundlegend transformative Veränderungen erfordern ein neues Denken, einen
systemischen Ansatz sowie eine sektorübergreifende Zusammenarbeit auf allen Ebenen (lokal, regional, global). Sie brauchen zudem Zeit in der Umsetzung und die Zustimmung der Bürger*innen. Hierauf sind die Wissenschaft, die Institutionen und die Politik mit ihren Steuerungsstrukturen nicht genügend vorbereitet. Sie verharren noch zu sehr in ihrem Silodenken. Klima- und Umweltschutz sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Ohne die Mitwirkung aller – Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Bürger*innen – kann die Transformation nicht gelingen. Dabei muss der Fokus auf Veränderung der Strukturen liegen, die klima- und umweltfreundliches Verhalten der Bürger*innen erst in relevantem Maße ermöglichen.
Psychologische Gründe und Klimakommunikation: Die Folgen der Erderwärmung wurden bei uns lange als etwas wahrgenommen, das uns selbst nicht direkt oder erst in ferner Zukunft bedroht. Inzwischen hat uns die Klimarealität eingeholt. Leugnung einer sonst vielleicht unerträglichen Realität und kognitive Dissonanz sind Abwehrmechanismen, um sich den Klimawandel schönzureden, denn sonst müsste man sein Verhalten ändern oder sich eingestehen, dass man für diese Entwicklung mit Verantwortung trägt.
Die neoliberale Entwicklung mit der kurzfristigen Nutzenorientierung und einer den Egoismus fördernden Individualisierung spielt eine weitere Rolle dabei, dass Menschen nicht ihrer Einsicht gemäß handeln. Zudem überfordern die vielen Krisen der letzten Jahre (Covid, Kriege, Inflation) vielfach die Menschen und Veränderung wird oft als Bedrohung erlebt. Für die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen spielt eine große Rolle, dass die Lasten und Vorteile fair verteilt werden.
24 KLIMAKRISE
30 Jahre lang haben die Wissenschaft und zivilgesellschaftliche Akteure geglaubt, Aufklärung und Information würden reichen, um das Bewusstsein für den notwendigen Wandel herbeizuführen. Das war naiv. Immer mehr alarmierende Meldungen über Katastrophen wirken eher kontraproduktiv, da sie Menschen hilflos machen. Menschen müssen auch emotional angesprochen und ihre Alltagsrealität berücksichtigt werden, um sie zu erreichen. Wissen allein führt meist nicht zu Engagement und Veränderung, wenn es nicht zum Handeln ermutigt.
Die Weigerung der Politik, der Klimaund Umweltkrise höchste Priorität einzuräumen: Es fehlt schlichtweg an politischem Willen. Sachliche Notwendigkeiten und Gemeinwohlinteressen sind in der Politik vielfach nicht bestimmend. Der eigene Machterhalt, der kurzfristige Zeithorizont, und mächtige Partikularinteressen stehen dem oft entgegen. Auch dass die Debatte um notwendigen Klimaschutz als Kulturkampf hochstilisiert wird, völlig losgelöst von inhaltlichen Erwägungen, trägt zur Polarisierung bei und erschwert eine parteiübergreifende Zusammenarbeit bei den Lösungen.
Rollback in der Klimapolitik und Strategiekrise der Klimabewegung
Die Fridays-for-Future Bewegung u.a. haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Thema 2019 weltweit auch politisch ganz oben auf der Tagesordnung stand. Durch die Coronakrise ist die Bewegung massiv geschwächt worden. Das „build back better“, eine zentrale Forderung aus der Coronazeit, Wirtschaft und Gesellschaft im Rahmen der Genesung (Recovery) ökologisch umzubauen, ist nicht eingetreten. Inzwischen rücken Regierungen und Unternehmen von vormals ambitionierten Klimazielen ab oder lassen es an Umsetzungswillen mangeln. Der Green Deal der EU, droht verwässert zu werden, der Naturschutz in der EU-Politik ist als

Folge der Bauernproteste gerade massiv geschwächt worden und die Aufhebung verbindlicher Sektorziele im Klimagesetz durch die Ampel steht bevor. Die Aussichten auf kommende Wahlen stimmen eher pessimistisch.
Die derzeitigen Kriege in der Ukraine und in Gaza haben die Klimakrise in den Hintergrund treten lassen. Die durch die Kriege ausgelösten bzw. verschärften Spannungen erschweren die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Klimawandels. Ganz abgesehen von dem erhöhten Treibhausgasausstoß und geringeren finanziellen Mittel für die sozial-ökologische Transformation. Erschwerend kommt hinzu, dass das Bundesverfassungsgericht den Plänen der Koalition einen Riegel vorgeschoben hat, Klimaschutzmaßnahmen über die Umwidmung der Coronagelder in den Klimafonds massiv zu fördern. Das Problem kann nur durch die Aufgabe bzw. Reform der Schuldenbremse und/oder deutliche Steuererhöhungen gelöst werden. Für beides sind derzeit keine Mehrheiten in Sicht.
Aus Angst vor der tagespolitischen Diskussion würden Zukunftsfragen gar nicht mehr diskutiert oder gelöst, die EU und viele Regierungen liefen vor den Fakten davon und knickten gegenüber der Lobby ein, so der NABU-Chef J.A. Krüger zum Rollback in der EU-Politik. „Grown-up leaders are pushing for a catastrophe“, schreibt Todd Stern, der ehemalige Klimachef der USA, im Guardian. Er wirft ihnen vor, dass sie ihre Klimaprogramme verlangsamten, mit der Begründung, sie seien unrealistisch. „Obviously it’s difficult – we’re talking about enormous change to the world economy – but we can do it.“
Was wir bräuchten, sei ein narrativer Wandel, ein Wandel in den Köpfen und Herzen, der den führenden Politiker*innen zeigt, dass ihre politische Zukunft von starken Klimaschutzmaßnahmen abhängt.
Trendwende in Teilen der Wirtschaft
Die fossile Industrie erschließt immer mehr neue Öl- und Gasfelder, obwohl laut der Internationalen Energieagentur neue Produktionsstätten unvereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel sind. Sie verabschiedet sich angesichts exorbitanter Gewinne aufgrund des Ukrainekrieges von den eigenen Verpflichtungen zur Klimaneutralität. Banken und Investoren finanzieren weiterhin fossile Energieunternehmen, weil dort jetzt kurzfristig höhere Renditen zu erwarten sind. Greenwashing bei Maßnahmen zur Dekarbonisierung ist weit verbreitet. Unternehmen und Finanzinstitutionen rücken, nicht zuletzt auf Druck ihrer Aktionäre oder der Politik (wie etwa in den von den Republikanern geführten USStaaten), von ihren vormals relativ klimafreundlichen Zielsetzungen ab.
Was lässt trotzdem hoffen?
In den letzten Jahren gab es positive Entwicklungen, die, bei aller Widersprüchlichkeit, Unvollkommenheit und Ungewissheit bei der Umsetzung, doch in die richtige Richtung gehen und Anlass zur Hoffnung geben:
Soziale Kippdynamiken
Neben Klimakipppunkten gibt es auch sogenannte soziale Kipppunkte, die ab Erreichen einer bestimmten Schwelle zu plötzlichen grundlegenden Änderungen
25
„Ein politischer Fortschritt (...) muss durc h einen unnachgiebigen, gut organisierten Kampf errungen werden. Politiker reagieren nicht auf das beharrliche
Wiederholen der Geschichte. Sie stellen sich nur dann einer Herausforderung, wenn sie mit einer Öffentlichkeit konfrontiert werden, die nach Veränderung schreit – und d ie, wenn sie ignoriert wird, die Macht der Politiker*innen bedroht.“ Bernard Lown
führen und einen transformativen Wandel auslösen können. Als Beispiele gilt der dynamische Ausbau der Erneuerbarer Energien, der inzwischen einen Kipppunkt erreicht hat und aufgrund des Preisvorteils (fast) ein Selbstläufer geworden ist. Das Finanzsystem kann plötzlich „kippen“, in dem Kapital massiv aus schmutzigen in „grüne“ Investitionen umgeleitet wird, wenn die entsprechenden Rahmbedingungen und Anreize durch staatliche Regulierung gegeben sind (z.B. CO2-Preis, Internalisierung der Kosten für Klima- und Umweltschäden in die Preise).
Auch das Bildungssystem kann, wenn auch erst längerfristig, ein transformatives Potential entfalten, da „transformative Bildung“ für Klima- und Umweltfragen sensibilisiert und vom „Wissen zum Handeln/Engagement“ führen kann. Laut Befragungen ist nach wie vor eine große Mehrheit in der Welt von der Dringlichkeit der Klimakrise überzeugt und hält Klimaschutz für wichtig bzw. sehr wichtig (in den USA sind es allerdings nur etwas über 50%).
Positive Politikansätze
Es gibt viele nationale und internationale Abkommen, Gesetze und Initiativen, die –bei allen Kompromissen und Widersprüchen – in die richtige Richtung gehen, so z.B. der EU Green Deal, der Inflation Reduktion Act in den USA mit einem massiven Investitionsprogramm für Erneuerbare Energien und grüne Technologien, das UN-Weltnaturabkommen, das vorsieht, bis 2030 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen, um die Biodiversität zu schützen, das EU-Renaturierungsgesetz (2024), das die Mitgliedstaaten verpflichtet, beschädigte Ökosysteme zu renaturieren und das UN-Abkommen zum Schutz der Meere, ein globaler Vertrag über Erhalt und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt der Hohen See (2023). Weiterhin zu nennen sind: Das UN-Abkommen gegen Plastikmüll, das derzeit verhandelt wird und die neue Luftqualitätsrichtlinie der EU, die
noch der finalen Zustimmung des Rates bedarf. Diese sieht eine deutliche Verschärfung der bisherigen Grenzwerte für Luftschadstoffe vor. wenn auch nicht die von Gesundheitsakteuren und Umweltverbänden bis 2030 geforderte volle Angleichung an die zum Teil deutlich schärferen Richtwerte der WHO.
Optimistisch stimmt auch die breit unterstützte Initiative für ein Ökozid-Abkommen auf UN-Ebene, die darauf hin arbeitet, Ökozid als zusätzliches der bisher drei großen Menschheitsverbrechen im Römischen Statut des Internationale Strafgerichtshofs (IStGH) zu verankern. Die EU hat in ihrer überarbeiteten Umweltdirektive einen dem Ökozid vergleichbaren Straftatbestand verabschiedet und in mehreren EU-Ländern liegen inzwischen Ökozid-Gesetze zur Abstimmung vor oder werden vorbereitet.
Die wichtige Initiative zu einem UN-Nichtverbreitungsvertrag für fossile Brennstoffe, die einen baldigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und Klimagerechtigkeit anstrebt, wird von vielen deutschen Gesundheitsorganisationen unter stützt. Auch die zahlreichen Klimaklagen gegen Staaten und Konzerne stimmen optimistisch. So z.B. die bahnbrechenden Urteile des Bundesverfassungsgerichtes vom Mai 2021, die Urteile niederländischer Gerichte, die ihre Regierung dazu verpflichten, mehr für Klimaschutz zu tun – bzw. das Unternehmen Shell dazu, seine Emissionen zu reduzieren (2021) – sowie das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR), das anlässlich der Klage von Schweizer Senior*innen gegen ihre Regierung erstmals anerkannte, dass unzureichender Schutz vor Klimawandel die Menschenrechte verletzt. Hier liegt ein großes Potential, Regierungen zur Verantwortung zu ziehen, das zu tun, wozu sie aufgrund ihrer Verfassungen bzw. Gesetze verpflichtet sind, und Unternehmen für die jahrelange Täuschung der Öffentlichkeit und für die Folgen ihrer Produkte zur Rechenschaft zu ziehen. Hier einzuordnen ist auch das
Urteil des OVG Berlin vom 17. Mai 2024 auf die Klage der Deutschen Umwelthilfe, dass die Klimaschutzprogramme für die Jahre 2030, um konkrete Maßnahmen ergänzt werden müssen.
Mobilisierung des deutschen Gesundheitssektors für Klimaschutz und planetare Gesundheit
Hoffnungsvoll stimmt auch die Anerkennung und Bedeutung, die das Thema Klimawandel und planetare Gesundheit inzwischen im deutschen Gesundheitssektor erfährt. Das Thema ist gesetzt, wenn auch noch nicht überall schon mit der wünschenswerten Tiefe und Priorität. Der Deutsche Ärztetag und der Deutsche Pflegerat haben sich zentral damit befasst und Stellung bezogen. Zahlreiche medizinische Fachgesellschaften positionieren sich inzwischen zum Klimaschutz bzw. planetarer Gesundheit und haben AGs gegründet, die das Thema in ihren Organisationen vorantreiben.
Zur dieser Erfolgsgeschichte hat KLUG, die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V., ganz wesentlich beigetragen. KLUG ist ein Netzwerk aus aktiven Einzelpersonen und Gesundheitsorganisationen, dem inzwischen Landesärztekammern, Universitätskliniken, Krankenkassen und gesundheitsorientierte NGOs angehören. KLUG hat die Bewegung Health for Future initiiert. Die IPPNW als Organisation hat KLUG von Anfang an begleitet und unterstützt.
Informationen und Kampagnen von KLUG finden Sie unter: www.klimawandel-gesundheit.de
Dr. Dieter Lehmkuhl ist IPPNWMitglied und engagiert sich bei KLUG e.V.

26

GESUNDHEITSBERUFE
BEIM KLIMASTREIK IN BERLIN
Hitzeschutzmaßnahmen
im deutschen Gesundheitswesen
Regionale Hitzeschutzbündnisse können zur Resilienz der Bevölkerung beitragen
Die Treibhausgasemissionen durch die Verbrennung fossiler Energieträger haben mit einer weltweiten Erhöhung der Temperaturen zu einem spürbaren Klimawandel geführt. Inzwischen werden in fast jedem Monat und Jahr neue Hitzerekorde vermeldet. In Deutschland ist die Temperatur seit 1881 um 1,8° Celsius gestiegen und liegt damit bereits deutlich über den Zielen des Pariser Klimagipfels von 2015.
Die Zeit wird zunehmend knapper, in der ohne weitgehende Beschränkung eigener Bedürfnisse eine gutes Klimakonzept und eine Reduktion der Treibhausgasemissionen wirksam werden kann. Durch den Klimawandel – der inzwischen als Klimakrise begriffen werden muss – kommt es nicht nur zu extremen Wetterereignissen. Die klimabedingte Zerstörung bisheriger Lebensgrundlagen führt zu großem Artensterben, sie schürt aber auch soziale Konflikte und führt zu Flucht und Migration. Die Verschlechterung der Luft- und Wasserqualität schafft veränderte Bedingungen für neue Erreger und verändert regionale Krankheitsspektren. Hitze und Hitzewellen als konkreter Ausdruck der klimatischen Veränderungen führen zu einer Erhöhung der Sterblichkeit und verstärkter Krankheitsausprägung vor allem unter den Hochrisiko-Gruppen. Hierzu gehören viele unserer chronisch erkrankten Patient*innen, Pflegebedürftige und Menschen mit hohem Medikamentenbedarf, betagte Menschen oder Kleinkinder, sozial Isolierte und Menschen in Pflegeeinrichtungen und in prekären Wohnsituationen, aber auch im Freien arbeitende Menschen.
Die Bekämpfung der gesundheitlichen Risiken der Klimakrise kann aber nicht nur als Gefahr, sondern auch als eine große Chance begriffen werden. Gerade als Ärztinnen und Ärzte können wir wesentlich zur Resilienz der Bevölkerung beitragen. Die Coronavirus-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie vulnerabel und wenig krisenfest unser Gesundheitswesen ist.
Als die deutsche Gesundheitsministerkonferenz 2020 die flächendeckende Erstellung von Hitzeaktionsplänen bis 2025 beschloss, ging es deshalb nicht nur um den Schutz von Patientinnen und Patienten, sondern vor allem auch um den Schutz vor einer Überlastung des Gesundheitswesens. Getan hat sich – wie 2024 festgestellt werden muss – in dieser Hinsicht noch nicht viel. Sicher haben einzelne Kommunen wie Mainz, Mannheim, Worms und andere mit hohem Aufwand und großem Detailreichtum nach meist langer Planungs- und Vorbereitungszeit Hitzeaktionspläne erstellt – Heidelberg, Freiburg und andere haben sich auf den Weg gemacht. Diese Anstrengungen sind aber arbeits- und personalintensiv und zumeist durch die verfügbaren behördlichen Ressourcen limitiert. Ärztliche Expertise fehlt häufig. Teilweise existieren zwar Arbeits- und Planungsbündnisse wie z. B. in Berlin, die sich eine regionale Strukturierung zur Aufgabe gemacht haben. Im April 2024 wurde in Ludwigsburg der erste Hitzeschutzplan für einen Flächenlandkreis der Öffentlichkeit vorgestellt. Vorausgegangen war ein zweijähriger Entwicklungsprozess an einem Runden Tisch mit verschiedenen Beteiligten (Ärzteschaft,
Gesundheitsamt, Kliniken, Schulen, Kitas, Pflegedienste, Pflegeheime etc.). Neben der Festlegung eines Alarmierungssystems auf dem Boden der Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden definierte Informationspfade festgelegt, über die Warninformationen und Informationsmaterialien verteilt werden konnten. Darüber hinaus wurden Muster-Hitzeaktionspläne entwickelt, die explizit zur Weiterverwendung und Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort genutzt werden können.
Die Nachricht ist klar: Ungeachtet dieser positiven Entwicklungen besteht ein hoher Bedarf an lokalen und überregionalen Hitzeschutzbündnissen, um die Vertreter*innen der verschiedenen Bereiche zum Austausch und zur Fortentwicklung miteinander vernetzen und wirksame Pläne zum Hitzeschutz im Gesundheitswesen zu entwickeln. Spätestens, wenn die Klimamodelle für die nächsten 50 Jahre zur Betrachtung herangezogen werden, wird offenkundig, dass uns nicht viel Zeit bleibt, um gravierende Gefahren für unsere Gesundheit und unseren Planeten abzuwenden.
Dr. Robin Maitra ist Mitglied des Vorstandes der deutschen IPPNW.

27 KLIMAKRISE
Foto:
Marlene Langenbucher
Klima- und Umweltfolgen des Gazakrieges
Wechselwirkungen von Krieg und Klima treten in Gaza verheerend zutage
Seit sieben Monaten führt Israel einen extrem brutalen Krieg in Gaza. In dieser Zeit hat die israelische Militäroffensive als Antwort auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober über 35.000 Palästinenser*innen in Gaza das Leben gekostet, davon mehr als 14.500 Kinder. Über 78.000 Menschen wurden verletzt, 75 % der Bevölkerung intern vertrieben sowie die Hälfte der Bevölkerung in die Hungersnot getrieben.
In den ersten drei Monaten des Krieges warf die israelische Luftwaffe laut offiziellen palästinensischen Angaben über 12.000 Bomben über Gaza ab, darunter Hunderte 1.000-Kilo-Bomben. In einem kürzlich veröffentlichen Bericht spricht die UN von einem seit 1945 nicht dagewesenen Ausmaß an Zerstörung in kürzester Zeit. Rund 60 % aller Gebäude und weite Teile der zivilen Infrastruktur sind zerstört oder beschädigt. Der kleine Landstrich wurde auf Jahre quasi unbewohnbar gemacht und wichtige Teil des kulturellen Erbes für immer zerstört. Bis heute hat die israelische Regierung weder ihre erklärten Kriegsziele erreicht, die Hamas zu eliminieren, noch alle der 240 Geiseln sicher nachhause zu bringen. Noch immer hält die Hamas über 100 Geiseln gefangen.
Inmitten dieses unvorstellbaren menschlichen Leids und Unrechts scheint der Blick auf die Klima- und Umweltfolgen des Konfliktes fast zweitrangig. Doch es ist wichtig, die Zusammenhänge zwischen den direkten und indirekten Folgen der Gewalt in den Blick zu nehmen und zu verstehen.
Der Konflikt trägt immens zur Klimakatastrophe bei in einer Region, die bereits von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Schon vor dem 7. Oktober 2023 führte die israelische Besatzungspolitik, die mit militärischer Gewalt aufrechterhalten wird,
dazu, dass Palästinenser*innen stark von Wasserknappheit, Lebensmittelknappheit, Landdegradation und Biodiversitätsverlust betroffen waren. Bemühungen um eine dekarbonisierte und klimagerechte Zukunft wurden in den besetzten palästinensischen Gebieten strukturell verhindert.
Allein die Kriegshandlungen in den ersten 60 Tagen nach dem 7. Oktober 2023 verursachten mehr Emissionen als 20 einzelne Länder in einem ganzen Jahr, so eine Studie von Forscher*innen aus Großbritannien und den USA. Über diese Klimaauswirkungen sprach die IPPNW im Rahmen eines Webinars im April mit dem britischen Geografen Benjamin Neimark, Professor an der Queen Mary University London, sowie dem kanadischen IPPNW-Arzt Tim Takaro, emeritierter Professor an der Simon Fraser University.
Die Umweltfolgen und Gesundheitsauswirkungen von Krieg, vom Einsatz spezifischer Waffen über die Produktion zur Entsorgung des toxischen Mülls auf Militärbasen, sind schon lange im Blick von Forschenden, Gesundheitsfachkräften und
Friedensaktivist*innen. Die Klimaauswirkungen von Rüstungsindustrie, Militär und Krieg hingegen waren lange unter dem Radar. Die Erhebung der nationalen militärischen Treibhausgasemissionen ist immer noch freiwillig unter der UN-Klimarahmenkonvention, die Datenlage lückenhaft. Diese Lücke zu füllen setzen sich Forscher*innen und Aktivist*innen zum Ziel. Dabei geht es nicht nur um die offensichtlichen Klimasünder wie etwa treibstoffintensive Kampfflugzeuge oder Panzer. Es geht auch darum, die „Infrastruktur des Krieges“ auf ihre Klimafolgen zu prüfen. In dem Projekt „Concrete Impacts“ ermitteln Forscher*innen um Benjamin Neimark mithilfe einer hybriden Life Cycle Analysis den Umweltfußabdruck von Wasser, Sand und Beton in den Lieferketten des US-Militärs im Irakkrieg und darüber hinaus. Die Arbeit zu den kilometerlangen Sprengwänden zeigt ausschnitthaft die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen der militärischen Invasion, globalisierten und CO2intensiven Infrastrukturträgern wie Beton und lokalen Umwelt- und Klimafolgen.
Für den Gazakrieg haben die Forschenden dementsprechend ausschnitthafte Be -
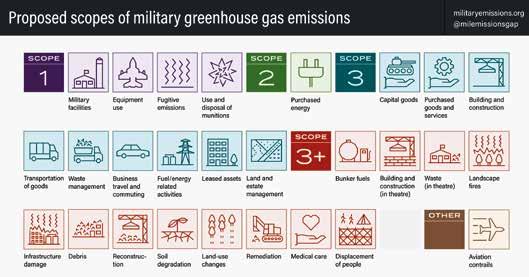
28
militaryemissions.org / Conflict and Environment Observatory

RAFAH: VERTRIEBENE STEHEN SCHLANGE, UM VON DER UN WASSER ZU BEKOMMEN, 5. MAI 2024
rechnungen der CO2-Emissionen entlang dreier Zeithorizonte vorgelegt. Sie berechnen, dass bestimmte Kampfhandlungen der ersten 60 Tage nach dem 7. Oktober 2023, insbesondere aus dem Einsatz von Kampfflugzeugen, Panzern, Munition, Bomben und Raketen, ca. 280.000 Tonnen CO2-Äquivalente (tCO2e) verursacht haben. Das ist etwa soviel, wie 75 Kohlekraftwerke über einen Zeitraum von einem Jahr ausstoßen. In einem zweiten Schritt berechnen die Autor*innen die Emissionen aus der Kriegs-Infrastruktur seit 2017. Hier werden einerseits die ca. 500 km langen Tunnel der Hamas aus Beton und Eisen, die sogenannte „Gaza Metro“, berücksichtigt. Deren Konstruktion hat 176.000 tCO2e verursacht. Dem gegenüber stehen 274.232 tCO2e aus der Errichtung des israelischen „Iron Wall“, der ca. 65 km langen Sperranlage um Gaza, bestehend aus Überwachungstechnologie und Sensoren, sowie Materialien wie Stacheldraht, Metallzäunen und Betonbarrieren. In einem dritten Zeithorizont werden die meisten Emissionen im Rahmen dieses Konfliktes projiziert: Sie betreffen den Wiederaufbau. Bereits bei Erarbeitung der Studie (12/2023) war das Ausmaß der Zerstörung von Wohngebäuden, Straßen, Wasseraufbereitungsanlagen, Kanalisation u.v.m. verheerend. Hier berechnen die Autor*innen die Emissionen aus dem Wiederaufbau von 100.000 Gebäuden, mindestens 30 Millionen tCO2e, entsprechend dem jährlichen Ausstoß Neuseelands.
Diese Erhebung ist bewusst ausschnitthaft, sie zeigt die hohen Emissionen aus nur einigen Kriegshandlungen bzw. kriegs-
bedingten Aktivitäten. Die tatsächlichen Klimawirkungen aus dem Konflikt sind sehr wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Wissenschaftler*innen des Projekts „Military Emissions Gap“ fordern daher systematische Erhebungen der Emissionen aus Rüstungsindustrie und Militär in Friedenszeiten entlang der drei Scopes des Greenhouse-Gas-Protokolls. Sie schlagen desweiteren die Einführung eines Scope 3+ vor, das die Emissionen aus Kriegshandlungen bemisst. Hierunter würden die Klimafolgen eines breiteren Spektrums an Kriegsfolgen wie beispielsweise Waldbrände, Landnutzungsveränderungen, Infrastrukturschäden, Wiederaufbau, medizinische Versorgung und die Versorgung Geflüchteter fallen.
Im Gazakrieg treten diese Wechselwirkungen besonders verheerend zu Tage. In dem dicht besiedelten Landstreifen ist die ohnehin unzureichende Wasserversorgung zusammengebrochen. Anfang des Jahres waren 70 % der Menschen gezwungen, versalzenes oder verunreinigtes Wasser zu trinken. Durch die Zerstörung der Energieversorgung fielen Wasseraufbereitungsanlagen und Abwasserpumpstationen aus. Toxischer Staub durch die Zerstörung von Gebäuden und darin enthaltenen Materialien wie mehrkernige aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), chlorierte Verbindungen und Dioxine gefährden die Gesundheit. Tonnen von teils toxischen Trümmern werden abgeräumt und aufbereitet werden müssen. Durch die Zerstörung von Gebäuden und Solarpaneelen werden klimatisierte Schutzräume in Hitzephasen fehlen, was besonders
Kinder und Ältere gefährdet. Die landwirtschaftliche Produktion im Gazastreifen war bereits durch die israelische Blockade, mangelnde Abfall- und Düngemittel-Regulation und die Klimakrise herabgesetzt. Im Zuge des Krieges wurden bis Februar 2024 etwa ein Drittel der Felder, Obstgärten und Olivenhaine zerstört oder verseucht.
Es ist die Aufgabe dieses Jahrhunderts, die großen Krisen von Krieg und Klimakatastrophe zusammen zu denken. Die Ursachen der Klimakrise können nicht effektiv angegangen werden, ohne auch die Gewaltstrukturen von Ungleichheit, Militarisierung und Krieg anzuprangern und zu verändern. Klimagerechtigkeit kann es nur für alle geben oder für niemanden.
Für den Krieg in Gaza bedeutet das, dass Klima- und Friedensbewegung sich gemeinsam für Solidarität, für einen sofortigen Waffenstillstand, für eine Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, ein Ende der deutschen Waffenlieferungen an Israel und eine politische Lösung des Konflikts einsetzen sollten.
Die Vorträge von Benjamin Neimark und Tim Takaro finden Sie hier: youtube.com/ippnwgermany
Laura Wunder ist Referentin für Klimagerechtigkeit und Global Health der deutschen IPPNW.

29
Anas-Mohammed / shutterstock.com
Zukunftskonferenz in Nairobi
IPPNW fordert dauerhafte Repräsentanz atomwaffenfreier Staaten im UN-Sicherheitsrat
Im September wird der Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen in New York stattfinden. Der UN- Generalsekretär António Guterres hat dafür Empfehlungen für eine neue Agenda für den Frieden formuliert. Guterres‘ Vision ist die eines „Multilateralismus in einer Welt im Wandel“. Darin sieht er fünf Handlungsbereiche: 1) Prävention auf globaler Ebene durch Abrüstung und präventive Diplomatie; 2) Prävention auf nationaler Ebene, etwa durch „nationale Präventionsstrategien“; 3) Zukunft von Friedenseinsätzen; 4) „neue Ansätze“, zum Beispiel zur verantwortlichen Nutzung neuer Technologien; und 5) UN-Reformen, hin zu einem repräsentativeren Sicherheitsrat, einer revitalisierten Generalversammlung und einer gestärkten Peacebuilding Commission, die als Beratungsorgan des UN-Sicherheitsrats und der Generalversammlung an der Schnittstelle von Frieden und Entwicklung eine größere Rolle zukommen soll.
Der Zukunftsgipfel wird von der UN in mehreren Schritten international vorbereitet. Am 9. Und 10. Mai 2024 fand dazu eine Civil Society Conference in Nairobi statt, an dem für die IPPNW Kelvin Kibet, Dennis Opondo und Bonaventure Machuka aus Kenia sowie Rolf Bader aus Deutschland teilnahmen und die Vorschläge der IPPNW einbrachten. Die IPPNW sieht das Leben und die Zukunft der Menschheit doppelt bedroht, durch die Gefahr des Atomkriegs und durch die fortschreitende Klimakrise. In Bezug auf die Atomkriegsgefahr fordert die IPPNW die Atomwaffenstaaten zu atomarer Abrüstung und zu einem Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag auf. Wegen der aktuellen Eskalationsgefahr im Ukrainekrieg sollten die fünf Atomwaffenstaaten, die gleichzeitig ständige Mitglieder im UNSicherheitsrat sind, sich gemeinsam verpflichten, auf einen Ersteinsatz von Atomwaffen zu verzichten – ein erster Schritt zu vertrauensbildenden Maßnahmen und atomarer Rüstungskontrolle.

Zur Lösung der Klimakrise empfiehlt die IPPNW, dass allgemeine und atomare Abrüstung wieder auf die internationale Tagesordnung gesetzt werden muss. Das anhaltende globale Wettrüsten und der kontinuierliche Anstieg der weltweiten Militärausgaben (2023 laut SIPRI 2443 Milliarden US-Dollar) sind für die Menschheit nicht weiter hinnehmbar. Globale Aufrüstung bewirkt, dass Ressourcen abgezogen werden, die dringend für die Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse und die Förderung der notwendigen globalen Klimaschutzmaßnahmen benötigt werden. Auch der CO2-Fußabdruck des Militärs, der bisher in der Klimaberichterstattung systematisch ausgespart wird, muss endlich verpflichtend in die Länderberichte an das UN-Klimasekretariat einbezogen werden.
Geopolitische Rivalitäten unter den fünf Atomwaffenstaaten und ständigen Mitgliedern des UN -Sicherheitsrat behindern diesen gravierend in seiner Entscheidungsfindung. Die IPPNW fordert daher eine stärkere Stimme der Nichtatomwaffenstaaten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Staaten, die sich jetzt schon freiwillig entschlossen haben, auf Atomwaffen zu verzichten, müssen festes Mitglied im Sicherheitsrat sein. Dafür kämen
zum Beispiel Südafrika in Frage, das den Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) schon ratifiziert hat, und Brasilien sowie Indonesien, die beide den AVV unterzeichnet haben und demnächst ratifizieren werden. So könnte die neue Norm, die sich durch den Atomwaffenverbotsvertrag gegen den herrschen Nuklearismus („Atomwaffen bis in alle Ewigkeit“) durchgesetzt hat, weiter gestärkt werden.
Der Prozess, wie der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten ist, könnte als Modell dienen, um die notwendigen Veränderungen in der Struktur des derzeitigen Sicherheitsrates einzuleiten und atomwaffenfreien Stimmen eine Vertretung im Sicherheitsrat zu geben. Auch die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN unterstützt diese Forderung.
Mehr zur Konferenz in Nairobi auf S. 34.
Dr. Angelika Claußen ist Co-Präsidentin der deutschen IPPNW.

30 WELT
BEI DER UN CIVIL SOCIETY CONFERENCE IN NAIROBI



Mut zum Frieden
IPPNW-Jahrestreffen in Frankfurt
Vom 26.-28. April 2024 fanden sich 160 Teilnehmer*innen zum IPPNW-Jahrestreffen in Frankfurt/Main zusammen. Die Vereinsmitglieder verabschiedeten einen politischen Leitantrag für atomare Abrüstung, Anträge gegen die Militarisierung des Gesundheitswesens und zur Vereinsöffnung. Mit einer Kundgebung auf dem Paulsplatz endete das Treffen am Sonntag. Ärzt*innen und Aktivist*innen demonstrierten für die Einhaltung der Menschenrechte in der Asylpolitik. In den Redebeiträgen wurde insbesondere die akute Vernachlässigung menschenrechtlicher Standards in der Gesundheitsversorgung geflüchteter Menschen kritisiert und auf die humanitären Konsequenzen von Kriegen verwiesen. Der ehemalige IPPNW-Vorsitzende Matthias Jochheim erinnerte an die aktive Rolle Deutschlands bei der Abschottungspolitik, die bereits Zehntausende Migrant*innen das Leben gekostet hat.

31
AKTION
HAGEN

Abrechnung mit der NATO
Pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum der NATO hat die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen eine kritische Übersicht über Struktur und Wirken des westlichen Militärbündnisses publiziert.
Zitat daraus: „Die Mythen der NATO verklären den Blick auf die Wirklichkeit. Um Auswege aus der gegenwärtigen Krise zu finden, bedarf es ihrer Enthüllung.“ Mit 130 Seiten ist das Werk recht schlank, dabei aber hochkonzentriert und vor allem ausgezeichnet struk turiert –was Zugang und Nutzbarkeit auch für zeit gestresste Friedensbewegte enorm steigert.
In zwölf Kapiteln werden Essentials wie Ukraine- und Gazakrieg, „Zeitenwende“, die Doppelmoral der NATO in puncto Völkerrecht und Demokratie, die Kooperation ihres Geheimdienstes mit dem Rechtsterrorismus und die Destabilisierung des Weltfriedens durch ihre globale Expansion sowie die Kündigung aller wichtigen Rüstungskontrollabkommen durch ihre Führungsmacht USA beleuchtet. Ein ganzes Kapitel ist Julian Assange als politischem Gefangenen der NATO gewidmet. Den Abschluss bildet der Ausblick „Frieden statt NATO“.
Autorin und Verlag ist es dabei gelungen, das Buch auf erstaunlichem Aktualitätsniveau herauszubringen und es mit einem höchst nützlichen, nach Kapiteln geordneten Quellenapparat zu versehen. Absoluten Seltenheitswert hat zugleich die politische Expertise von Dagdelen: Für ihren scharf friedensfokussierten Blickwinkel kann sie sich auf fast 20 Jahre Erfahrung als MdB stützen. Sie ist seit vielen Jahren Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages (heute als Obfrau für das BSW) und der Parlamentarischen Versammlung der NATO und gehört der Parlamentariergruppe USA, der deutsch-chinesischen sowie der deutsch-indischen Parlamentariergruppe an. Entsprechend gut ist sie international vernetzt.
Mein Fazit: Für Friedensbewegte ist – auch im Internetzeitalter – die Lektüre des sehr gut lesbaren Buches ein großer Gewinn. Unter den oben genannten Blickwinkeln ist es derzeit konkurrenzlos – und seinen Preis von 16 Euro mehr als wert.
Sevim Dagdelen: Die NATO: Eine Abrechnung mit dem Wertebündnis. 128 S., 16,- Euro, Westend, Frankfurt 2024, ISBN: 978-3-86489-467-1
Christoph Krämer

Zu viele Informationen
Wenn Sie wissen wollen, wie ein ausgewachsener Atomkrieg aussehen könnte, wie er auf plausible Weise beginnen (und enden) könnte, ist Annie Jacobsens Buch sehr wertvoll.
Ein Blick auf die umfangreichen Anmerkungen und das Literaturverzeichnis (fast 60 Seiten) zeigt, dass sehr viel Auswand in die Recherchen geflossen ist. Es geht um nukleare Strategien und Zielpläne, die Auswirkungen einer oder mehrerer Explosionen, den gefährdeten Fortbestand der Regierung, die Nutzlosigkeit der Raketenabwehr, Probleme von Missverständnissen und Fehleinschätzungen und viele andere Aspekte. Der wichtigste Punkt ist jedoch: Jacobsens Buch zeigt, dass die nukleare Abschreckung, wenn sie scheitert, zum Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, führen wird. Dieser Punkt muss verstanden werden, wenn wir die Politik davon überzeugen wollen, Atomwaffen abzuschaffen. Aus diesem Grund habe ich das Buch zunächst als Kampagneninstrument begrüßt.
Allerdings ist dieses Atomkriegsszenario nicht unbedingt plausibel. Ein „Blitz aus heiterem Himmel“ mag das sein, „was jeder in Washington am meisten fürchtet“, ist aber nicht das wahrscheinlichste Szenario. Jeffrey Lewis geht in seinem „2020 Commission Report on the North Korean Nuclear Attacks against the US“ ausführlich darauf ein, wie ein nuklearer Angriff aus Nordkorea auf die USA zustandekommen könnte. Annie Jacobsen jedoch erklärt nicht, wie es zu dem beschriebenen Angriff gekommen ist. Wenn wir andere überzeugen wollen, dass die Abschreckung scheitern wird, muss die Erklärung plausibel sein.
Mein Hauptkritikpunkt ist, dass es zu viele Informationen gibt. Es reicht schon, sich damit auseinanderzusetzen, dass ein einziger Atomsprengkopf einen totalen Atomkrieg auslöst, der zu einem nuklearen Winter führt. Schon das ist die Vorstellung des Unvorstellbaren. Doch Jacobsen reiht eine Katastrophe an die andere und versucht anscheinend, alle von ihr recherchierten „Was wäre wenn“-Forschungen zu nutzen. Problematisch sind zudem Fehler, die nur Atomexpert*innen bemerken und in den sozialen Medien kommentiert haben. Übrigens wird man nicht geblendet, wenn man auf eine Atomexplosion schaut, sondern, wenn man den Blitz vor der Explosion sieht. Trotzdem empfehle ich dieses Buch. Aber lesen Sie es nicht, bevor Sie schlafen gehen. Sonst werden Sie Probleme beim Einschlafen haben.
Annie Jacobsen: 72 Minuten bis zur Vernichtung. Atomkrieg. 400 S., 22,- Euro, Heyne, München 2024, ISBN: 9783453218789. Xanthe Hall
32 GELESEN
JUNI
Thesen zur Verteidigung der Migrationsgesellschaft

Liebe Mitglieder, aufgrund unseres Umzuges schließt der IPPNW-Shop bis zum 24. Juni 2024.
Antifaschismus ist eine Notwendigkeit und Migration die Realität einer demokratischen Gesellschaft. Doch vielerorts wird Migration zum Problem schlechthin stilisiert, der eigene Rassismus hingegen ausgeblendet: Vor den Europawahlen hat die „Antifaschistischen Plattform zur Verteidigung der Migrationsgesellschaft“ diese acht Thesen veröffentlicht.
Falz flyer DIN lang, kostenlos | Bestellen unter: shop.ippnw.de Download: ippnw.de/bit/8-thesen
IPPNW-Akzente Türkei
Die Teilnehmer*innen der IPPNW-Türkeireise berichten von der Situation von politischen Gefangenen und ihren Angehörigen, von der Arbeit in Adiyaman, einer vom Erdbeben stark betroffenen Stadt, von Umweltproblemen, von der systematischen Vertreibung von Kurd*innen aus ihren angestammten Gebieten, von den unfairen Bedingungen vor der Kommunalwahl und von der Situation Geflüchteter im Transitland Türkei.
Verfügbar ab August 2024 unter: shop.ippnw.de Download: ippnw.de/bit/tuerkei-24
GEPLANT

Das nächste Heft erscheint im September 2024. Das Schwerpunktthema ist:
Atomwaffenverbot und Opferhilfe
Der Redaktionsschluss für die Ausgabe 179 /September 2024 ist der 31. Juli 2024. Das Forum lebt von Ihren Ideen und Beiträgen. Schreiben Sie uns: forum@ippnw.de
IMPRESSUM UND BILDNACHWEIS
Herausgeber: Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzt*innen in sozialer Verantwortung e. V. (IPPNW) Sektion Deutschland
Redaktion: Dr. Lars Pohlmeier (V.i.S.d.P.), Angelika Wilmen, Regine Ratke
Anschrift der Redaktion: IPPNWforum, Frankfurter Allee 3, 10247 Berlin, Tel.: 030 6980 74 0, Fax 030 693 81 66, E-Mail: ippnw@ippnw.de, www.ippnw.de, Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE 23 4306 0967 1159 3251 01, BIC: GENODEM1GLS
Das Forum erscheint viermal jährlich. Der Bezugspreis für Mitglieder ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Sämtliche namentlich gezeichnete Artikel entsprechen nicht unbedingt der Meinung
der Redaktion oder des Herausgebers. Nachdrucke bedürfen der schriftlichen Genehmigung. Redaktionsschluss für das nächste Heft: 31. Juli 2023
Gestaltungskonzept: www.buerobock.de, Layout: Regine Ratke
Druck: DDL Berlin Papier: Circle Offset, Recycling & FSC.
Bildnachweise: S.7 Mitte: jcomp / freepik.com. Nicht gekennzeichnete Fotos: privat oder IPPNW.
19.6. 30 Jahre IPPNW-Regionalgruppe Nürnberg-Fürth-Erlangen: Medizinische Friedensarbeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Nürnberg
JULI
1.7. Erhöhte Krebsraten durch Atomwaffentests, Vortrag von Dr. Tilman Ruff (IPPNW) in Hamburg
3.-7. 7. Camp für Klimagerechtigkeit und nukleare Abrüstung in Nörvenich bei Köln. Mehr unter: buechel.nuclearban.de
SEPTEMBER
14.9. Einweihungsfeier der neuen IPPNW-Geschäftsstelle in der Frankfurter Allee 3, Berlin
16.9-27.9. Menschenrechtler*innen aus dem Südosten der Türkei besuchen Frankfurt (M) und Berlin:
20.09. Fachtag zu psychosozialer Arbeit mit Expert*innen aus der Türkei im Rahmen der kurdischen Delegationsreise, Berlin
OKTOBER
14.10. Side-Event der DPGG zum World Health Summit in der Staatsbibliothek Berlin
25.10. Nuklearer Fallout: Ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen des zivil-militärischen Atomkomplexes. Fachtagung Atommüllreport in Hannover. Mehr unter: atommuellreport.de
Weitere Informationen unter: www.ippnw.de/aktiv-werden/termine
Anmelden!
33 NÖRVENICH BEI KÖLN 3.-7. 7. 2024
Camp für Klimagerechtigkeit und nukleare Abrüstung: buechel.nuclearban.de
TERMINE
GEDRUCKT

1Rolf, Du hast für die IPPNW an der UN Civil Society Conference in Nairobi teilgenommen, wo eine Reform der UN vorbereitet wurde. Was war Dein erster Eindruck? Über 600 Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler*innen internationaler Einrichtungen und Diplomat*innen verschiedener Staaten haben in Nairobi intensiv zusammengearbeitet, dabei stammten 70 % aller Teilnehmer*innen aus den Staaten Afrikas. Fast 40 % von ihnen waren junge Menschen.
2Wie hat sich diese junge Generation bei der Konferenz eingebracht? Zusammen mit Dr. Kelvin Kibet, Bonventure Machuka und Dennis Opondo (IPPNW Kenia) nahm ich an einer Sitzung der deutschen UN-Botschafterin und ihres namibischen Kollegen teil, die sich mit ca. 50 jungen afrikanischen Teilnehmer*innen zu einem Austausch trafen. Diese forderten von den beiden Botschaftern Mit- und Entscheidungsrechte für die junge Generation in den Gremien der UN. Sie wünschen sich Strukturen, die ihnen Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der UN ermöglichten. Ihr Ziel ist, den afrikanischen Interessen mehr Gewicht zu verleihen und der jungen afrikanischen Generation mehr Gehör zu verschaffen. Sie forderten Bildungsmaßnahmen und deren Finanzierung über die UN Besonders Mädchen müssten gefördert werden.
3Sicherlich war hier auch die Klimakrise zentrales Thema.
Die jungen Leute kritisierten, die Auswirkungen des Klimawandels träfen vor allem Afrika, das nicht der Verursacher sei. Die Folgen sind bekannt: Verwüstung, Versteppung, Trockenheit, Dürre, Wassermangel. Millionen Menschen sind betroffen, Hunger, Elend und millionenfacher Tod die katastrophale Konsequenz. Abschließend forderten zwei Teilnehmer noch völlig berechtigt einen Sitz eines afrikanischen Staates im UN-Sicherheitsrat. Ich war sehr beeindruckt von diesem Austausch.
4Was sind die zentralen Punkte des Zukunftspakts, der in Nairobi entstanden ist? Der inzwischen vorliegende Entwurf „Pact for the Future“ ist unter Berücksichtigung von 400 Statements und Expertisen entstanden. Natürlich war es nicht rea-
6 Fragen an
Rolf Bader
IPPNW-Mitglied und ehemaliger
Geschäftsführer der deutschen Sektion
listisch, alle Vorschläge und Wünsche im Pact zu erfassen. Auf knapp 20 Seiten habe man sich mit 148 Absätzen für allgemeine Formulierungen entschieden, die den Weg für eine Reform der UN umreißen würden. Der dickste Brocken sei die angestrebte Reform des UN-Sicherheitsrats, für die im Juni 2024 ein Vorschlag präsentiert werden solle, so Namibias UN-Botschafter Neville Gertze. Derzeit müsse man noch rechtliche Fragen klären und Gespräche mit einflussreichen Mitgliedsstaaten führen. Die IPPNW sieht im Atomwaffenverbotsvertrag ein Vorbild für notwendige Veränderungen in der Struktur des UN-Sicherheitsrates. Deshalb forderte sie in einem Statement, den atomwaffenfreien Staaten des Globalen Südens eine starke Vertretung im Sicherheitsrat zu geben.
5Was für eine Rolle spielte Deutschland bei der Konferenz? Besonders wichtig war aus meiner Sicht die Mitwirkung der für die Planung des Zukunftsgipfels zuständigen deutschen UNBotschafterin Antje Leendertse und des namibischen Botschafters Neville Gertze. Beide drückten ihre große Dankbarkeit für die überwältigende Mitwirkung der Zivilgesellschaft aus. Die Überzeugungsarbeit für eine Reform der UN müsse weltweit von der Zivilgesellschaft geleistet werden. Ich hatte zum Glück auch die Gelegenheit, mit Frau Leendertse kurz über das IPPNW-Statement zu sprechen.
6Welche Rolle spielte das Thema Frieden? Die Konferenz sendete ein deutliches Signal an die Mitgliedsstaaten, das Friedensgebot der UN-Charta zu achten. Nairobi wurde als Tagungsort ausgewählt, um die Belange Afrikas stärker zu gewichten. Die ungleiche Verteilung von Lebenschancen zwischen Staaten des Südens und des Nordens ist eine wesentliche Ursache von Spannungen und gewaltsamen Konflikten. Der Abbau des Protektionismus, die Entschuldung und gerechte Handelsstrukturen sind deshalb eine zentrale Aufgabe des Zukunftsgipfels. Trotz zu erwartender Widerstände einflussreicher UN-Mitglieder, werden jetzt die Weichen für eine Reform der UN gestellt – damit wird ihre Handlungsfähigkeit für den Frieden in der Welt gestärkt
34 GEFRAGT
…

Broschüre zum Bestellen
Im humanitären Bereich hat das Werben um Erbschaften und Nachlässe eine lange Tradition. Der Vorstand der IPPNW hat sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, diese Möglichkeit den eigenen Mitgliedern, Fördererinnen und Förderern anzutragen. Den Einsatz für Ziele, die Ihnen am Herzen liegen, können Sie durch ein Vermächtnis oder ein Erbe nachhaltig unterstützen. Diese zwölfseitige Broschüre informiert Sie, welche Fragen dabei zu bedenken sind.
Ihr Nachlass gestaltet: Über den Tag hinaus
Ich bestelle ...... Exemplare der Broschüre „Über den Tag hinaus die Zukunft mitbestimmen: Vererben oder vermachen an einen gemeinnützigen Verein“.
Deutsche Sektion
Frankfurter Allee 3 10247 Berlin
Name Straße Plz, Ort E-Mail Unterschrift
IPPNW
issuu.com/ippnw Fax: 030 693 81 66






Wir ziehen um!
Liebe Mitglieder und Unterstützer*innen,
es gibt gute Nachrichten: Nach mehreren Wochen Ausmisten, Archivieren von Büchern, Broschüren und Ordnern, dem Scannen von Unterlagen, Verschenken und Verkaufen von Möbeln und Geräten in der Körtestraße und Bau- und Sanierungsarbeiten in der Frankfurter Allee ist es bald so weit: Am 17. Juni 2024 wird die neue IPPNW-Geschäftsstelle in BerlinFriedrichshain eröffnet.
Unsere neue Adresse: IPPNW e. V. Frankfurter Allee 3 10247 Berlin (Nähe U Frankfurter Tor)
Vom 27. Mai 2024 bis voraussichtlich 16. Juni 2024 sind wir aufgrund unseres Umzuges in die neuen Büroräume telefonisch nicht erreichbar. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Kommen Sie zur Einweihungsfeier am 14. September 2024 !
Herzlich einladen möchten wir Sie im Namen der Geschäftsstelle und des Vorstands zur der Einweihung unseres neuen Büros am 14. September in der Frankfurter Allee 3. Damit wir besser planen können, bitten wir Sie um Anmeldung, wenn Sie an der Einweihungsfeier teilnehmen möchten: ippnw.de/ bit / einweihung