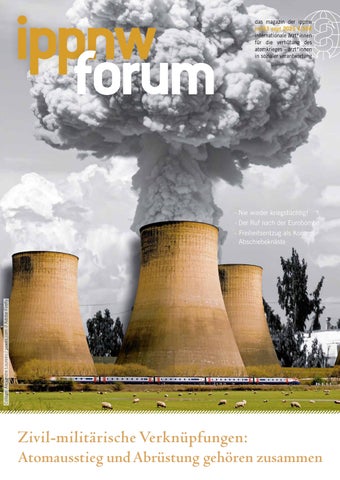7 minute read
Erinnerungen schweigen nicht.
Wir brauchen sie – jetzt!
Im Gespräch mit Sozial- und Gesundheitswissenschaftlerin Prof. Dr. Annelie Keil
Die militärische Geschichte eines Krieges ist eine andere Geschichte als die der Menschen, die den Krieg erlitten und als Lebensgeschichte und Erinnerung in sich tragen. Prof Dr. Annelie Keil forscht darüber, wie Kriegserfahrungen in Menschen nachwirken und was uns friedensfähig machen kann.
Frau Keil, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist wieder Krieg in Europa. Was haben Sie damals als Kind erlebt?
Kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges unehelich geboren, kam ich 1939 in ein Kinderpflegeheim der Nationalsozialisten in Berlin. Dieses Heim wurde 1940 nach Ciechocinek verlegt, ein polnisches Kurbad in der Nähe von Posen. Ich wurde zusammen mit den anderen Heimkindern Teil des wahnsinnigen Programms der Nazis, Polen einzudeutschen. Den Jahren einer friedlichen Kindheit in einem besetzten Land folgten dann dramatische Jahre der Flucht als Hitler am 17. Januar 1945 alle Deutschen aufforderte, Polen zu verlassen. Meine Mutter, die im besetzten Polen Arbeit gefunden hatte, holte mich aus dem Heim und gemeinsam traten wir im Treck mit anderen fliehenden Menschen zu Fuß die Flucht nach Westen an. Auf dem Weg kamen wir für zwei Jahre in russisch-polnische Kriegsgefangenschaft, meine Mutter entkam der Verschleppung nach Sibirien, später gelang uns die Flucht aus dem Gefangenenlager und so landeten wir über Berlin 1947 im Grenzdurchgangslager Friedland.
Wie hat ihre Biografie als Kriegskind Ihr Engagement für den Frieden geprägt?
Als Kind auf der Flucht habe ich viel gelernt über Solidarität, Durchhaltevermögen, Selbständigkeit und das Mitgefühl von fremden Menschen. Als ich als Jugendli- che und später als Studentin bewusster und kritischer wurde für das, was um mich herum geschah, suchte ich nach Möglichkeiten, Widerspruch zu üben, aufzubegehren und ersten Widerstand zu leisten gegen die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik, die Notstandsgesetze, die Stationierung von Raketen, gegen Atomwaffen, gegen Diskriminierung, Ungerechtigkeit, Armut – gegen vieles, was meiner Meinung nach ein friedliches, menschenfreundliches und respektvolles Zusammenleben der Menschen in einer freiheitlichen Demokratie verhinderte.
Auf dem IPPNW-Jahrestreffen haben Sie für eine Wissenschaft plädiert, die sich den Kriegserfahrungen der Menschen stärker zuwendet...
Kriege enden nicht, wenn sie vorbei sind, wenn die Waffen schweigen oder ein politischer Friedensvertrag auf irgendeinem Papier unterzeichnet wird. Meine Erfahrung ist, dass die persönlichen Erfahrungen der Menschen, die den Krieg überlebt haben, in vielen Wissenschaften kaum eine Rolle spielt. Ich glaube, es gibt ein unglaubliches historisches Material der Überlebensfähigkeit. Wir reden hier von dem, was Menschen zu Tausenden, zu Millionen gelitten haben. Aber wie dieses Leiden aussah, was die Konsequenzen daraus waren und was das für die Erziehung, die Medizin, für die Psychologie und Psychotherapie bedeutet, das ist immer noch eine große Leerstelle.
Was ließe sich hier entdecken?
Ein Ergebnis solcher Dokumentationen könnte veranschaulichen, dass paradoxerweise eine „besondere und vor allem andere Kriegstüchtigkeit“ vieler Menschen gerade darin besteht, die Folgen und Gefährdungen für Leib und Leben im Krieg und vor allem danach mit größter Anstrengung, Phantasie, Überlebenswillen und Solidarität zu bewältigen und für sich und andere fruchtbar zu machen. Diese spezifische Art der „Kriegstüchtigkeit“ könnte die Wurzel einer umfassenden Friedensfähigkeit sein, wenn wir nicht nachlassen, über die Frage „Warum Krieg?“ nachzudenken.
Sie schreiben, Frieden brauche mehr als das „Nein“ zum Krieg. Was sind wichtige Elemente einer „Theorie des Friedens“?
Vor kurzem ist eine Textsammlung des Sozialpsychologen und Friedenskämpfers Erich Fromm unter dem Titel „Humanismus in Krisenzeiten. Texte zur Zukunft der Menschheit“ erschienen. Die darin enthaltene konkrete Utopie über die „Eine Welt“ und die Bedeutung des Humanismus für die Gegenwart sind mir selbst immer wieder zu Leitgedanken für die eigene Orientierung geworden. „Ohne einen neuen Humanismus gibt es die Eine Welt nicht“, schreibt Erich Fromm.
Zentral ist zum Beispiel das, was Erich Fromm „Biophilie“ nennt – die besondere Liebe zum Leben. Dem Menschen ist in der Liebe zum Leben vieles möglich, das es auf dem Weg zum friedlichen Zusammenleben zu unterstützen, zu fördern und zu ermutigen gilt. Nicht nur in der Katastrophenhilfe, auch in funktionierenden Nachbarschaften und ökologischen Projek- ten zur Veränderung der Lebenswelten können wir Belege für das finden, was in einem umfassenden Sinn lebendige Sinnstiftung ist.
Für eine ausgebaute Theorie des Friedens brauchen wir eine sehr viel weiter ausgebaute Theorie vom Menschen, so Fromm – die die Spaltung zwischen Affekt und Denken mit Blick auf die Entstehung und Zunahme von Feindseligkeit in den Blick nimmt und für die Frage nach Kriegsbereitschaft oder Friedensfähigkeit auswertet. Die Abspaltung wichtiger Lebenserfahrungen führe zunehmend zu einem Desinteresse, das viele Lebensbereiche umfasst. Die „Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben“ war für ihn „eine der gefährlichsten Ursache für die Bereitschaft des Menschen, andere und sich selbst zu zerstören.“
Albert Schweitzer wiederum hat den Begriff der „Ehrfurcht vor dem Leben“ geprägt...
Schweitzer spricht – auch mit Blick auf sein Erleben im ersten Weltkrieg – von der Nötigung, allem Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. Der Anerkennung und dem Respekt gegenüber dieser „Ehrfurcht vor dem Leben“ verweigert sich jeder Krieg in all seinen Schattierungen und mit all seinen Begründungen, als Krieg mit Bomben und Raketen, als sozialer Krieg, als Krieg in den Innenräumen menschlichen Zusammenlebens. Daraus folgt für mich, dass die Friedensbewegung kein politisches Tagesgeschäft mit Erfolgsgarantie ist – sie ist ein dem menschlichen Leben innewohnender Auftrag, das Recht, die Würde und den Willen zum Leben aller Menschen zu hüten und zu fördern. Dem, das uns unmittelbar trifft, muss unsere Tatkraft gehören, an ihm schult sich unsere Lebendigkeit, hier entsteht Welt- und Lebensbejahung, aber auch Lebensverneinung.
Könnten Sie diesen Gedanken bitte noch ein wenig ausführen?
Ich erinnere mich an eine lang zurückliegende Diskussion während einer Demonstration gegen die Stationierung amerikanischen Raketen mit der Theologin Dorothee Sölle und dem Arzt und Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter über die Zukunft der Friedensbewegung, in der Richter seine Verwunderung darüber zum Ausdruck brachte, dass vor allem die jungen Aktivisten in der Friedensbewegung jede Information über die Standorte, die Art der Waffen und die militärische Einsatzplanung der Raketen im Kopf hatten, aber sich sehr wenig mit dem Sinn, der Bedeutung und der inhaltlichen Zielsetzung der Friedensbewegung, nämlich sinnstiftend leben zu wollen und zu können, auseinandergesetzt hatten. Die Frage, wofür es sich zu leben lohnt, schien abgekoppelt und verschwand unter dem Druck, möglichst umfassend die faktische Bedrohung durch die Raketenstationierung im Auge zu haben.
Wie könnte die Friedensbewegung diese Lehren Fromms und Schweitzers umsetzen?
Wir brauchen in Familie, Schule, gesellschaftlichen Institutionen und vor allem in der zivilgesellschaftlichen Entwicklung mehr spezifische Formen der Achtsamkeit und Förderung jener Lebenskraft, die lieben, kämpfen und sich im täglichen Leben durchsetzen kann. Die gleichzeitig auch geduldig ist, die Ungleichzeitigkeit dulden und erdulden kann, die langfristigen Widerstand entwickelt, Konkurrenz und Vielfalt annehmen und aushalten lernt.
Friedensfähigkeit braucht eine andere Art von Politik, Wissenschaft und ethisch-humanistischer Ansprache, die nicht immer weiter vom „gesamten Menschen“ trennt, sondern zusammenführt, was zusammengehört. Für die Friedensbewegung verlangt das die Einsicht, dass die isolierende Organisation der Entrüstung nicht ausreicht und dass diese mit Hass, Dominanz und Rechthaberei gepaart uns oft genau von denen entfremdet, an die es zu appellieren gilt. Wir müssen anders verstehen, dialogisch erklären und im Kontext von Zweifeln aufklären lernen. Wir sind aufgefordert, neue Möglichkeiten der Demokratie zu erarbeiten, auch wenn diese selbst sich immer wieder als Teil einer großen Farce manifestiert. Wie kann man die existierende parlamentarische Demokratie durch neue Formen der Beteiligung ergänzen? In der Geschichte der verschiedensten sozialen und zivilgesellschaftlichen Bewegungen hat sich immer wieder gezeigt, dass Ideen, die sich der Ideenlosigkeit gegenüberstellen, eine unerwartete Durchschlagskraft haben können. Es ist nicht leicht, mit den Widersprüchen und den Paradoxien im Dialog zwischen Krieg und Frieden, Kriegstüchtigkeit und Friedensfähigkeit umzugehen und sich der Unsicherheit der Vergeblichkeit zu stellen –aber meiner Meinung nach eine der wenigen Möglichkeiten, die bleiben.
Annelie Keil ist emeritierte Professorin für Sozial- und Gesundheitswissenschaften in Bremen und Mitglied der IPPNW. Ihre Rede auf dem IPPNW-Jahrestreffen finden Sie unter: ippnw.de/bit/vortrag.
Das Interview führte Regine Ratke.